Was uns die knalligen Gefängnisse des Künstlers zu sagen haben

Praktisch und gut, und in seiner Schlichtheit beinahe magisch: Das Quadrat ist einer der wichtigsten Bausteine für die Pioniere der abstrakten Kunst des 20. Jahrhunderts. So diente es für Kasimir Malewitsch etwa – in Schwarz und Weiß – der Befreiung der Kunst von der „Schwere der Gegenstände“. Josef Albers machte es mit seinem berühmten Werkzyklus „Homage to the Square“ („Huldigung an das Quadrat“) zu seinem Markenzeichen und fand in der perfekten Form einen Raum für freies Spiel mit der Farbe. Universell, ewig und vollkommen: Das Quadrat wurde zu einem „quasi-religiösen Kultobjekt“, schreibt Guillermo Solana, der künstlerische Leiter des Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, im Vorwort zum Ausstellungskatalog „Peter Halley en España“.
Und Peter Halley (New York, 1953), der nun mit einer Retrospektive im Casal Solleric geehrt wird, war es, der bei diesem Kult ausscherte und „um die Ecke dachte“. Im Grunde genommen ein Querdenker, bevor dieser Begriff im Zuge der Pandemie einen Beigeschmack bekam. Tatsächlich hat seine Kunst aber sogar einen Lockdown-Bezug: „Halley sah das Quadrat auf eine andere Weise: als Grundeinheit der Begrenzung, der räumlichen Isolation. Und dagegen rebellierte er mit einer respektlosen, ikonoklastischen Geste“, schreibt Solana.
Gefängnisse und fensterlose Zellen

Zur Erläuterung wählt er den folgenden Vergleich: So wie Marcel Duchamp einst einer Reproduktion der Mona Lisa einen Schnurrbart und Spitzbart verpasst hatte, malte Peter Halley vertikale Streifen ins Innere des Quadrats und verwandelte es somit in das vergitterte Fenster, das Gefängnis: seine erste Ikone. Dann nahm er sich das Quadrat erneut zur Brust, füllte es mit einer strukturierten Tupfung und schuf eine zweite Ikone: die fensterlose Zelle. In Halleys Gemälden werden diese beiden Ikonen durch Schächte und Schornsteine ergänzt, sodass eine schematische, klaustrophobische Architektur entsteht.
Das wirklich Radikale und Besondere dabei ist aber, dass der seit den frühen 1980ern aktive Künstler der Geometrie eine neue Bedeutungsebene gab, die darüber hinausgeht, auf konkrete und bekannte Formen anzuspielen: Seine Werke illustrieren die Strukturen, die unser Handeln in der heutigen Gesellschaft bestimmen. Halley wehrte sich stets gegen das Etikett „Abstrakte Kunst“. Vielmehr sollten seine Arbeiten auf diagrammatische Art und Weise die Steuerungsvorgänge des modernen Lebens repräsentieren: einer post-industriellen, elektronischen, digitalen und oft geometrisch geordneten Welt.
Gegen die "Geometrisierung" des Lebens
Für die klassischen Künstler der Abstraktion im 20. Jahrhundert verkörperte die Geometrie ein erstrebenswertes Ideal von Reinheit, Ordnung und Vernunft. Bei Halley hingegen bekommt sie etwas Dystopisches: Er betrachtet sie als Sprache der Unternehmens- und Verwaltungswelt, der Stadtplanung und der Telekommunikation. So prangert er in den Essays, von denen er zahlreiche im Laufe seiner Karriere schrieb, die „Geometrisierung“ unseres Lebens an.
Und das schon zu einer Zeit, die noch weitgehend analog funktionierte. Der Einzug neuer Technologien in unsere Lebensrealität, die von Isolierung und permanenter Vernetzung zugleich geprägt ist, findet bei Halley Niederschlag in einer fluoreszierenden Farbpalette, die die Energie von Bildschirmen heraufbeschwört. In seinen neueren Kompositionen durchbricht die freie, schwebende Bewegung der Elemente das Format der Leinwand. Solana schreibt: „In diesen shaped canvases, die einem Tanz von Quadraten und Rechtecken gleichen, befreit sich Halley auf wundersame Weise vom Quadrat als Gefängnis.“
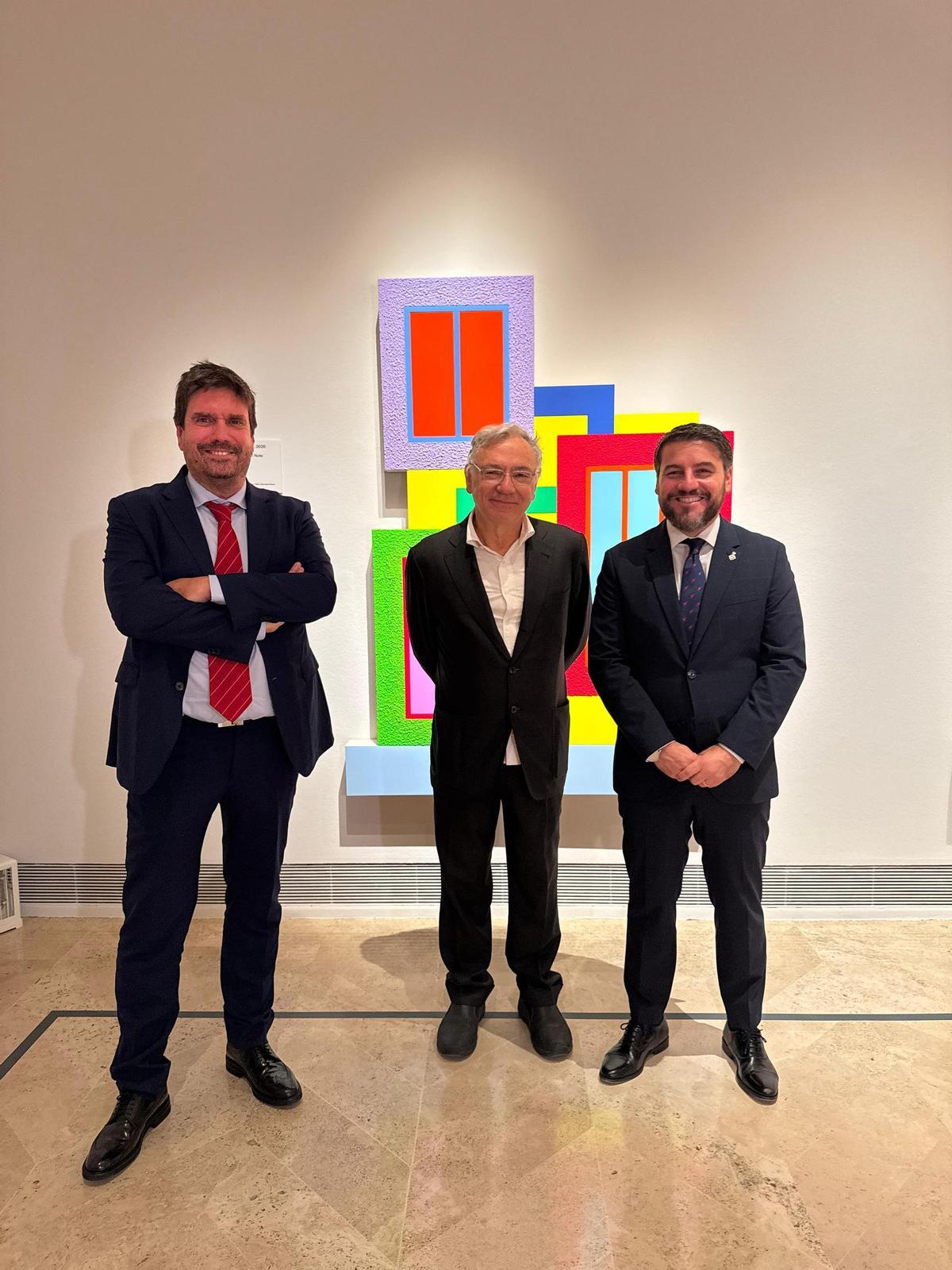
Peter Halley (Mitte) mit Fernando Gómez de la Cuesta (li.) und Kulturstadtrat Javier Bonet. / Rathaus Palma
Erste Retrospektive in Spanien seit 1992

Seit Mitte der 1990er schuf der US-Amerikaner, dessen Arbeiten sich unter anderem im Museum of Modern Art, der Tate Gallery und der Sammlung des Guggenheim Museums befinden, auch ortsspezifische Installationen. Dieser Teil seiner Aktivität bleibt auf Wunsch des Künstlers aber bei der Ausstellung in Palma außen vor; sie befasst sich nur mit der Entwicklung seiner Malerei.
Halley wählte auch persönlich die 20 gezeigten Arbeiten aus, die im Zeitraum von 1985 bis 2024 entstanden. Sie stammen aus privaten und öffentlichen spanischen Sammlungen. Bei der Schau handelt es sich um die erste Retrospektive in Spanien seit 1992, und um eine Kooperation mit dem Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid. Dort war sie bis zum 19. Januar vor der zweiten Station in Palma zu sehen.
„Peter Halley en España“, 22. März, 12 Uhr, bis 25. Mai, Casal Solleric, Passeig del Born, 27, Eintritt frei.
Abonnieren, um zu lesen
var enableHeroPianoSticky=true;
window.ID5EspConfig={partnerId:1326};
(function() {
var a = window.location.hostname;
a = a.substring(a.lastIndexOf(".", a.lastIndexOf(".") - 1) + 1);
switch (a) {
case "lne.es":
case "diaridegirona.cat":
case "diariodeibiza.es":
case "diariodemallorca.es":
case "farodevigo.es":
case "informacion.es":
case "levante-emv.com":
case "laopinioncoruna.es":
case "superdeporte.es":
case "laopiniondemalaga.es":
case "laopiniondemurcia.es":
case "laopiniondezamora.es":
case "laprovincia.es":
case "regio7.cat":
case "eldia.es":
case "mallorcazeitung.es":
case "emporda.info":
case "diariocordoba.com":
case "stilo.es":
case "codigonuevo.com":
case "elperiodicomediterraneo.com":
case "elperiodicodearagon.com":
case "elperiodicoextremadura.com":
case "sport.es":
case "elperiodico.com":
case "elperiodico.cat":
case "epe.es":
case "elcorreogallego.es":
case "elcorreoweb.es":
case "lacronicabadajoz.com":
case "neomotor.com":
break;
default:
a = "prensaiberica.es"
}
var b = document.createElement("script");
b.type = "text/javascript";
b.src = "https://analytics-cdn." + a + "/static/javascript/mo_wp.min.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b)
}
)();
!function(){var n=window._sf_async_config=window._sf_async_config||{};n.uid=63417,n.domain=window.location.hostname.split(".").slice(-2).join("."),n.useCanonical=!1,n.useCanonicalDomain=!1,n.path=window.location.pathname,n.flickerControl=!1}();
if("https://www.mallorcazeitung.es/"===window.location.pathname){const e=document.createElement("script");e.src="https://static.chartbeat.com/js/chartbeat_mab.js",e.async=!0,document.head.appendChild(e)}
(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l="+l:"';j.async=true;j.src="https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id="+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-K3F8ZWT');
(function () {
window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
var slotsFirstCallPI = [
'300izdad',
'cpm_fmega',
'980',
'cpm_me'
];
var executePostMessage = function () {
if (!googletag.pubadsReady || googletag.pubads().getSlots().length < 2) {
setTimeout(executePostMessage, 200);
console.log("googletag.pubadsReady undefined, waiting...");
return;
}
console.log("[PUBLICIDAD] execute post message fired");
var prefix = screen && screen.width < 768 ? "movil-" : "pc-";
googletag.cmd.push(function () {
slotsFirstCallPI.forEach(function (slot) {
var slot_refresh = prefix + "div-gpt-ad_" + slot;
googletag.pubads().getSlots()
.filter(function (s) {
return s.getSlotElementId() == slot_refresh;
})
.forEach(
function (s) {
googletag.pubads().refresh([s], { changeCorrelator: false });
}
);
});
});
}
var enableRefreshAds = function () {
if (window.app && window.app.ads && window.app.ads.adMap) {
app.ads.adMap.disableRefreshAd = false;
}
if (typeof module != "undefined" && module.siteConfigOptions) {
module.siteConfigOptions.disableRefresh = false;
}
googletag.enableServices();
}
if (!location.pathname.match(//fotos/.*.html/)) {
console.log("[PUBLICIDAD] no es url de fotos");
if (window.app && window.app.ads) {
app.ads.flagManager.subscribe(app.ads.flagManager.flags.CMP_READY | app.ads.flagManager.flags.ADS_INITIALIZED, function () {
executePostMessage();
});
} else {
executePostMessage();
}
window.ADNPM = window.ADNPM || {}; ADNPM.cmd = ADNPM.cmd || [];
var script = document.createElement("script");
script.type = "text/javascript";
script.src = "https://cdn.netpoint-media.de/1270735.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);
} else {
// esta parte se ejecuta en bitban todavía
console.log("[PUBLICIDAD] es url de fotos");
enableRefreshAds();
if (window.app && window.app.ads) {
app.ads.flagManager.subscribe(app.ads.flagManager.flags.CMP_READY | app.ads.flagManager.flags.ADS_INITIALIZED, function () {
googletag.pubads().refresh();
});
} else {
googletag.pubads().refresh();
}
}
})();
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',
'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
fbq('init', '785493233455956');
fbq('track', 'PageView');[["ShallowReactive",1],{"data":2,"state":4,"once":11,"_errors":15,"serverRendered":6,"path":17,"pinia":18,"hashedFiles":1366},["ShallowReactive",3],{},["Reactive",5],{"$scheckAd-0-html":6,"$sstateAdSlot-0":7,"$sshowInTextAd-1-mobile-0-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-1-desktop-0-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-mobile-0-6-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-desktop-0-6-html-false":8,"$scheckAd-1-article":8,"$sshowInTextAd-1-mobile-1-2-article-false":8,"$sshowInTextAd-1-desktop-1-2-article-false":8,"$sshowInTextAd-2-mobile-1-6-article-false":8,"$sshowInTextAd-2-desktop-1-6-article-false":8,"$scheckAd-2-html":8,"$sshowInTextAd-1-mobile-2-2-html-false":6,"$sshowInTextAd-1-desktop-2-2-html-false":6,"$sshowInTextAd-2-mobile-2-6-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-desktop-2-6-html-false":8,"$scheckAd-3-heading":8,"$sshowInTextAd-1-mobile-3-2-heading-false":8,"$sshowInTextAd-1-desktop-3-2-heading-false":8,"$sshowInTextAd-2-mobile-3-6-heading-false":8,"$sshowInTextAd-2-desktop-3-6-heading-false":8,"$scheckAd-4-html":8,"$sshowInTextAd-1-mobile-4-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-1-desktop-4-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-mobile-4-6-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-desktop-4-6-html-false":8,"$scheckAd-5-html":6,"$sstateAdSlot-5":9,"$sshowInTextAd-1-mobile-5-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-1-desktop-5-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-mobile-5-6-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-desktop-5-6-html-false":8,"$scheckAd-6-heading":8,"$sshowInTextAd-1-mobile-6-2-heading-false":8,"$sshowInTextAd-1-desktop-6-2-heading-false":8,"$sshowInTextAd-2-mobile-6-6-heading-false":8,"$sshowInTextAd-2-desktop-6-6-heading-false":8,"$scheckAd-7-html":8,"$sshowInTextAd-1-mobile-7-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-1-desktop-7-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-mobile-7-6-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-desktop-7-6-html-false":8,"$scheckAd-8-html":8,"$sshowInTextAd-1-mobile-8-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-1-desktop-8-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-mobile-8-6-html-false":6,"$sshowInTextAd-2-desktop-8-6-html-false":6,"$scheckAd-9-photo":8,"$sshowInTextAd-1-mobile-9-2-photo-false":8,"$sshowInTextAd-1-desktop-9-2-photo-false":8,"$sshowInTextAd-2-mobile-9-6-photo-false":8,"$sshowInTextAd-2-desktop-9-6-photo-false":8,"$scheckAd-10-heading":8,"$sshowInTextAd-1-mobile-10-2-heading-false":8,"$sshowInTextAd-1-desktop-10-2-heading-false":8,"$sshowInTextAd-2-mobile-10-6-heading-false":8,"$sshowInTextAd-2-desktop-10-6-heading-false":8,"$scheckAd-11-html":8,"$sshowInTextAd-1-mobile-11-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-1-desktop-11-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-mobile-11-6-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-desktop-11-6-html-false":8,"$scheckAd-12-html":6,"$sstateAdSlot-12":10,"$sshowInTextAd-1-mobile-12-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-1-desktop-12-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-mobile-12-6-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-desktop-12-6-html-false":8,"$scheckAd-13-html":8,"$sshowInTextAd-1-mobile-13-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-1-desktop-13-2-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-mobile-13-6-html-false":8,"$sshowInTextAd-2-desktop-13-6-html-false":8},true,"u003Cdivn data-ad-position="300dcha-2"n data-type-ad="mobile"n title="cpm_r_dcha"n id="movil-div-gpt-ad_300dcha-2">n u003C/div>",false,"u003Cdivn data-ad-position="300dchab-2"n data-type-ad="mobile"n title="cpm_r_dchab"n id="movil-div-gpt-ad_300dchab-2">n u003C/div>","u003Cdivn data-ad-position="300dchac-2"n data-type-ad="mobile"n title="cpm_r_dchac"n id="movil-div-gpt-ad_300dchac-2">n u003C/div>",["Set",12,13,14],"$STzuwnpPEz","$O6d5EdaaaP","$O0cI25xSbT",["ShallowReactive",16],{},"/kultur/ausstellungen/2025/03/21/peter-halley-casal-solleric-115508564.html",["Reactive",19],{"configStore":20,"contentStore":295,"menuLinkStore":1293,"menuStore":1320,"cacheStore":1327,"adsStore":1328,"adsNewStore":1340,"section":1357,"authorStore":1359,"boardStore":1360},{"data":21,"vars":156,"fonts":179,"translations":180},{"nameRSS":22,"language":23,"isRegional":6,"footerMediaMiddleName":24,"media":25,"mediaAds":26,"place":27,"mediaNameDsFile":28,"mediaNameDsFileRegionales":29,"mediaCompleteName":30,"openings":31,"oficialSite":33,"nameMainSectionLink":34,"basicsSocialNetworksUrls":35,"socialNetworksUrls":39,"headersLinks":41,"legalNoticeUrl":45,"hasPrefix":8,"prefixType":46,"placementId":51,"region":56,"hasLanguage":8,"photoQuality":57,"GTM":68,"amp":73,"trustProject":76,"pianoScriptAid":77,"urls":78,"editionOptionsCountries":100,"rrssShareUrls":106,"tempVideoAdunit":47,"restyling":6,"dataApi":108,"jwPlayerLibraryUrl":113,"premium":114,"dataLayer":115,"config499":124,"closeContent":6,"authorModalActivated":8,"newDisqussActivated":6,"logo":143,"logoSchema":144,"defaultLiveImage":145,"timeZone":146,"freeHtml":6,"ga4Url":147,"ampCss":148,"analyticsCdn":149,"analyticsDomain":150,"pianoStickyHeader":151},"@mz_tweets","de_DE","Verlag Editorial Paneurope S.A.","MAZ","mz","Mallorca","mallorca-zeitung","regionales","Mallorca Zeitung",[32],"mallorcazeitung_tv","https://www.mallorcazeitung.es","Raíz temáticas SP",[36,37,38],"https://www.facebook.com/MallorcaZeitung","https://twitter.com/mz_tweets","https://www.instagram.com/mallorcazeitung/",{"facebook":36,"twitter":37,"instagram":38,"linkedin":40},"https://www.linkedin.com/company/mallorca-zeitung/",{"premium":42,"show_profile":43,"save_news":44},"https://meinaccount.mallorcazeitung.es/tp/abonnement/galerie","https://meinaccount.mallorcazeitung.es/tp/profil","https://meinaccount.mallorcazeitung.es/tp/profil/favoriten","protecciondatos?gdprTipo=3",{"article":47,"photogallery":48,"video":49,"live":47,"liveSport":50},"","/fotos","/videos","/directo",{"cpm_m":52,"cpm_r_dcha":53,"cpm_r_dchab":54,"cpm_r_dchac":55},"y5b0jizQS8","j2kN6Uh4hG","6733oJsKBE","6xPCgXHpKz","de",{"qualityList":58,"qualityBoard":59,"qualitySource":60,"quality_16_9":61,"quality_libre_1200":62,"quality_media_libre":63,"quality_alta_libre":64,"source_aspect_ratio":65,"quality_16_9_extralarge":66,"free_crop":67},"mobile_sp_clipping","1_1_clipping","source_image","16_9_clipping","malaga_libre_1200","media_libre_clipping","alta_libre_clipping","source-aspect-ratio","16_9_extralarge","free_crop",{"GTMaccount":69,"AmpGTMaccount":70,"sectionLevel1":71,"portada":72},"GTM-K3F8ZWT","GTM-M7F2778","malaga","portada",{"mediaId":74,"urlLogoHeader":75,"urlLogoFooter":75},"MallorcazeitungAmp","logo-regionales-mallorca-zeitung-amp.svg",{"enabled":8},"3ys0njtBpe",{"traffic":79,"subscribers":80,"direct":81,"previewTemp":47,"esi":82,"miCuenta":99},"https://www.mallorcazeitung.es/estaticos/data/cmp/prensaiberica-de.js","/es/suscriptores/","/es/directos/",{"header":83,"commons":90,"amp":93},{"themesMenuPage":84,"linksNavBarMenu":85,"linksSideBarMenu":86,"linksFromMegaMenu":87,"editionMenuPage":88,"mobileMenuPage":89},"/cds-statics/esi/header/themes-menu","/cds-statics/esi/header/links-bar-menu","/cds-statics/esi/header/links-side-bar-menu","/cds-statics/esi/header/links-side-and-nav-bar-menu","/cds-statics/esi/header/edition-menu","/cds-statics/esi/header/mobile-menu",{"theMost":91,"theAlert":92},"/cds-statics/esi/commons/the-most","/cds-statics/esi/commons/the-alert/",{"hotTopics":94,"headerSideBar":95,"theMost":96,"theAlert":97,"headerSideBarAggregates":98},"/cds-statics/esi/amp/header/hot-topics","/cds-statics/esi/amp/header/links-side-bar","/cds-statics/esi/amp/the-most","/cds-statics/esi/amp/the-alert/","/cds-statics/esi/amp/header/links-side-bar-aggregates","https://micuenta.mallorcazeitung.es",[101],{"title":102,"class":103,"url":104,"name":105},"ES","link","https://www.mallorcazeitung.es/","España",{"twitter":107},"https://twitter.com/mz_tweets/status/",{"idSite":109,"idsWidget":110,"siteIdBcube":112},"26",[111],"83","45","https://cdn.jwplayer.com/libraries/UF3oKRuQ.js","REGISTERED",{"page":116,"product":118,"content":122},{"ga4_id":117},"G-KSW24HB1EZ",{"area":29,"brand":119,"platform":120,"name":121,"core":121},"mallorca zeitung","web","mallorcazeitung",{"language":123},"castellano",{"activated":6,"domainExceptions":125,"includedTypes":137,"date":140},[126,127,128,129,130,131,33,132,133,134,135,136],"http://mallorcazeitung-local.prensaiberica.es:3000","http://mallorcazeitung-int.prensaiberica.es","https://mallorcazeitung-int.prensaiberica.es","http://mallorcazeitung-pre.prensaiberica.es","https://mallorcazeitung-pre.prensaiberica.es","http://www.mallorcazeitung.es","http://mallorcazeitung.es","https://mallorcazeitung.es","https://www-pro.mallorcazeitung.es","http://www-pro.mallorcazeitung.es","http://localhost:3000",[138,139],"article","live",{"year":141,"month":142,"day":142},"1900","01","logo-regionales-mallorca-zeitung.svg","logo-regionales-mallorca-zeitung.png","imagen-generica-directos.jpg","Europe/Madrid","https://analytics-cdn.mallorcazeitung.es/static/json/ga4.json","regional","https://analytics-cdn.mallorcazeitung.es","mallorcazeitung.es",{"anonymous":152,"registered":153,"subscriberPaper":154,"subscriberPDF":154,"subscriberUnknown":155},"https://estaticos-data.prensaiberica.es/statics/data/guitar_player/templates/26/OTVYU856TKLY/OTVC4K2X2S30G.html","https://estaticos-data.prensaiberica.es/statics/data/guitar_player/templates/26/OTVYU856TKLY/OTVCWXH3BVORR.html","https://estaticos-data.prensaiberica.es/statics/data/guitar_player/templates/26/OTVYU856TKLY/OTVE9ENZWZJSJ.html","https://estaticos-data.prensaiberica.es/statics/data/guitar_player/templates/26/OTVYU856TKLY/OTVXG38MDXQTU.html",{"activateDeleteItems":6,"activateOcioSection":6,"ampActivated":6,"miCuentaUrl":157,"urlSite":33,"apiDomain":158,"krolikDomain":159,"staticsUrl":160,"sitedataDomain":161,"tempIncludedUrlSections":162,"priusDomain":33,"ampDomain":33,"disqusConfig":163,"staticsCmsUrl":168,"videoUrlLegacy":47,"wholeSite":6,"disabled499ForBoardAutomatics":6,"disabled499ForBoardManual":8,"wholeSiteExcludedSections":169,"sectionsExcludes":170,"disqusSecretKey":171,"hasCanonicalElement":8,"playerMediaConfig":172,"theMostSegmentationActivated":6,"showAlert":6,"ampSuffix":174,"amp499Suffix":175,"canonicalContent":176,"oneTapActivated":6,"lastModifiedCustomKey":177,"activateParseUrl":6,"activateNavbarNavigation":8,"activateRobotsTxt":6,"theMostSectionActivated":8,"manualJsonAppActivated":6,"theMostSectionPath":178,"isSiteWithSubscriber":8,"hashedFilesActivated":8},"https://meinaccount.mallorcazeitung.es","https://pubfrontal.mallorcazeitung.es","https://krolik.mallorcazeitung.es","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es","https://sitedata.mallorcazeitung.es",[],{"sso":164,"apiKey":167,"shortname":29},{"name":121,"url":165,"logout":166},"https://www.mallorcazeitung.es/susp/register/login.html","https://www.mallorcazeitung.es/es/html/logout","muh0GFzaT7mFSzA7QlCKKByNRQiboWW3pg4GnANNwGQOBN0P5lE2eR1IaS2gDiGK","https://www-cms.mallorcazeitung.es",[],[],"client key pro",{"testMode":6,"autoStart":6,"detectDevice":8,"playerUrl":173,"forcePlayerPlay":8},"https://cdn.jwplayer.com/libraries/Z1Ur7XIB.js",".amp.html",".ampcds.html",[138,139],"x-last-modified","meistgelesen",[],{"translations":181,"translationsMonths":273,"translationsShortsMonths":286},{"updateText":182,"isNews":183,"kickerEquivalentTypes":184,"tooltipText":193,"inLive":191,"tooltipTitle":204,"via":214,"othersNewsFrom":215,"commentBox":216,"boardButton":217,"themes":218,"footerText":219,"showGallery":220,"showVideo":221,"ads":222,"onlyLogo":223,"withTheSupportOf":224,"search":225,"sponsorship":226,"theMost":229,"viewMoreNewsFrom":217,"allRightsReserved":236,"legalNotice":237,"privacyAndCookiesPolicy":238,"privacyAndCookiesPolicyPath":239,"complaintsChannel":240,"privacyPreferences":241,"openSearchEngine":242,"searchEngine":243,"closeSearchWindow":244,"enterYourSearch":245,"errorMessage":246,"openLogin":247,"becomePremium":248,"viewProfile":249,"viewSavedNews":250,"logout":251,"openMenu":252,"topics":218,"watchVideo":253,"subscribe":254,"alreadyPremiumLogIn":255,"here":256,"editProfile":257,"openSidebar":258,"relatedNews":259,"comments":260,"updated":261,"interestYou":262,"searchButtonUrl":263,"subscribeText":264,"press":265,"radioTv":266,"magazine":267,"thematicChannels":268,"texts":269,"canonicalElement":47,"sportLiveInProgress":270,"sportLiveFinished":271,"ethicalCode":272},"Aktualisiert","Aktuell",{"BB_531610":47,"finished":185,"exclusive":186,"interView":187,"history":188,"board":189,"confidential":190,"live":191,"news":192},"So haben wir es euch erzählt","Exklusiv","Interview","Geschichte","Titelseite","Vertraulich","Live","Nachricht",{"analyst":194,"fAct":195,"obituari":196,"servici":197,"review":198,"investig":199,"suportBy":200,"shopping":201,"opinion":202,"content":203},"Interpretation der Nachrichten auf der Grundlage von Fakten, einschließlich Daten, sowie Interpretation der möglichen Entwicklung des Themas auf der Grundlage vergangener Ereignisse.","Überprüft eine bestimmte Aussage oder eine Reihe von Aussagen, die als Fakten präsentiert werden. Gibt ein Urteil darüber ab, ob die Aussage korrekt ist oder nicht.","Informiert über den Tod einer Person und liefert einen unvoreingenommenen Bericht über ihr Leben, ihre Kontroversen und ihre Leistungen.","Nicht journalistische Inhalte, die den Lesern als informationsinteressant angeboten werden.","Nicht-journalistische Inhalte, die den Lesern als interessante Informationen angeboten werden.","Tiefgehende Untersuchung eines einzigen Themas, die umfangreiche Recherche und Ressourcen erfordert.","Produziert mit finanzieller Unterstützung einer Organisation oder Einzelperson, aber nicht vom Abonnenten vor oder nach der Veröffentlichung genehmigt.","Diese Angebote wurden unabhängig von einem Team von elPeriódico basierend auf ihren Kriterien und Erfahrungen ausgewählt. elPeriódico verdient eine Provision aus den Verkäufen über die Links auf dieser Seite. Alle Kaufpreise in diesem Artikel sind aktuell.","Basierend auf den Interpretationen und Urteilen des Autors über Fakten, Daten und Ereignisse.","Markeninhalt",{"analysis":205,"factCheck":206,"services":207,"obituary":208,"review":209,"investigation":210,"supportedBy":211,"sponsoredShopping":212,"opinion":213},"Analyse","Faktencheck","Dienstleistungen","Nachruf","Rezension","Untersuchung","Unterstützt von","Gesponsertes Einkaufen","Meinung","durch","Weitere Nachrichten von","Kommentieren","Weitere Artikel","THEMEN","Andere Websites von Prensa Ibérica Media:","Galerie anzeigen","Video anzeigen","Werbung","Nur Logo","Mit Unterstützung von","Suchen",{"sponsoredContentWithoutLogo":227,"secsponsor":211,"epbrands":228,"newssponsor":211}," Branded Content","Ein Projekt von",{"lastNews":230,"mostRead":233},{"href":231,"title":232},"/neu/","Neu",{"href":234,"title":235},"/meistgelesen/","Meistgelesen","Alle Rechte vorbehalten","Rechtlicher Hinweis","Datenschutz- und Cookie-Richtlinien","/datenschutzerklarung/","Beschwerdekanal","Datenschutzeinstellungen","Suchmaschine öffnen","Suchmaschine","Suchfenster schließen","Geben Sie Ihre Suche ein","Fehlermeldung","Anmeldung öffnen","Jetzt Premium-Mitglied werden","Profil anzeigen","Gespeicherte Nachrichten anzeigen","Abmelden","Menü öffnen","Um dieses Video anzusehen, abonniere oder melde dich an, %s wenn du bereits Abonnent bist.","Abonnieren","Bist du bereits Premium? Melde dich an","hier","Profil bearbeiten","Seitenleiste öffnen","Verwandte Nachrichten","Kommentare","Aktualisieren","Das könnte dich interessieren","https://www.mallorcazeitung.es/suche","Abonnieren, um zu lesen","Presse","Radio und Fernsehen","Zeitschriften","Themenkanäle",{"Últimas noticias":232},"SPIEL LÄUFT","BEENDET","Ethischer Kodex",[274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285],"Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember",[287,288,276,289,278,279,280,290,291,292,293,294],"Janu","Febr","Apri","Augu","Sept","Okto","Nove","Deze",{"content":296,"postSelected":896,"hasBeenPaginated":8,"isAmpContent":8},{"metas":297,"components":372,"internalRelatedContents":710,"socialNetworksInformation":711,"keywords":714,"signature":-1,"sponsorship":-1,"dates":715,"published":6,"multimedias":719,"url":17,"sections":799,"tags":809,"hyperlocalisms":833,"urls":834,"site":121,"frontMultimedia":-1,"options":835,"id":1263,"originalId":1263,"relations":1264,"authors":1279,"contentType":138,"contentId":1263,"headers":1282,"breadcrumb":1284},{"metaKeywords":298,"customMetas":299,"metaTitle":370,"metaCanonicalURL":17,"metaDescription":330,"metaRobots":371},"peter,halley,casal,solleric,kunstler,Kunst,Madrid,Casal Solleric,Palma,Mallorca,Ausstellungen,Art Palma Brunch",[300,303,306,309,312,315,318,320,323,325,328,331,334,337,340,342,344,347,350,353,356,359,361,363,365,367],{"name":301,"content":302},"pimec:tags","132,192,193,264",{"name":304,"content":305},"iab:tags","201,552,8VZQHL,155,432",{"property":307,"content":308},"fb:pages","372406080462",{"property":310,"content":311},"fb:app_id","572370999466092",{"http-equiv":313,"content":314},"Content-Type","text/html; charset=UTF-8",{"name":316,"content":317},"generator","BBT bCube NX",{"name":319,"content":30},"publisher",{"name":321,"content":322},"author","Brigitte Rohm",{"property":324,"content":138},"og:type",{"property":326,"content":327},"og:title","Nieder mit dem Kult um das "perfekte" Quadrat: Was uns die knalligen Gefängnisse von Peter Halley zu sagen haben",{"property":329,"content":330},"og:description","Abstraktion trifft Konzept: Das Casal Solleric und das Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid widmen dem renommierten US-amerikanischen Künstler auf Mallorca eine Retrospektive",{"property":332,"content":333},"og:image","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg",{"property":335,"content":336},"og:image:width","1200",{"property":338,"content":339},"og:image:height","675",{"property":341,"content":17},"og:url",{"property":343,"content":30},"og:site_name",{"property":345,"content":346},"article:modified_time","2025-03-21T14:53:37Z",{"property":348,"content":349},"article:published_time","2025-03-21T14:48:28Z",{"property":351,"content":352},"article:section","Ausstellungen",{"property":354,"content":355},"article:tag","kunstler,Kunst,Madrid,Casal Solleric,Palma,Mallorca,Ausstellungen,Art Palma Brunch",{"name":357,"content":358},"twitter:card","summary_large_image",{"name":360,"content":22},"twitter:site",{"name":362,"content":327},"twitter:title",{"name":364,"content":330},"twitter:description",{"name":366,"content":333},"twitter:image",{"name":368,"content":369},"origin","CDS","Peter Halley auf Mallorca: Was uns die knalligen Gefängnisse des Künstlers zu sagen haben","index,follow",{"frontTitle":-1,"shortSubtitle":-1,"subtitle":373,"title":327,"epigraph":-1,"kicker":374,"bodyComponents":376,"corrigenda":705,"subtitleComponents":706},"u003Ch2>Abstraktion trifft Konzept: Das Casal Solleric und das Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid widmen dem renommierten US-amerikanischen Künstler auf Mallorca eine Retrospektiveu003C/h2>",{"specialText":375,"text":-1,"type":-1},"BB_531610",[377,380,597,599,604,606,608,611,613,615,696,699,701,703],{"data":378,"type":379},"u003Cp class="ft-text">Praktisch und gut, und in seiner Schlichtheit beinahe magisch: u003Cstrong>Das Quadratu003C/strong> ist einer der wichtigsten Bausteine für die Pioniere der abstrakten u003Ca class="ft-link ft-link--decoration" href="/tag/kunst/" target="_blank">Kunstu003C/a> des 20. Jahrhunderts. So diente es für Kasimir Malewitsch etwa – in Schwarz und Weiß – der Befreiung der Kunst von der „Schwere der Gegenstände“. Josef Albers machte es mit seinem berühmten Werkzyklus „Homage to the Square“ („Huldigung an das Quadrat“) zu seinem Markenzeichen und fand in der u003Cstrong>perfekten Formu003C/strong> einen Raum für freies Spiel mit der Farbe. Universell, ewig und vollkommen: Das Quadrat wurdeu003Cstrong> zu einem „quasi-religiösen Kultobjekt“u003C/strong>, schreibt Guillermo Solana, der künstlerische Leiter des Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, im Vorwort zum Ausstellungskatalog „Peter Halley en España“.u003C/p>","html",{"data":381,"type":138},{"articleView":382},{"authors":383,"contentId":391,"contentType":138,"dates":392,"id":396,"multimediaType":397,"options":398,"originalId":391,"photoClippings":419,"published":6,"sections":511,"liveOptions":-1,"signature":-1,"sponsorship":-1,"subtitle":-1,"epigraph":-1,"tags":529,"hyperlocalisms":592,"title":593,"type":138,"url":594,"urls":595,"order":596},[384],{"name":322,"id":385,"originalId":386,"title":322,"url":387,"image":388,"description":389,"authorInformation":-1,"active":6,"urls":390},"e74d5ac8-2548-3055-ac7d-46b1b76cb4ac","28519","https://www.mallorcazeitung.es/autoren/brigitte-rohm.html","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5b1503b4-2ffb-453f-8c2c-abeebca6611a_source-aspect-ratio_320w_0.jpg","u003Cp>Geboren in Stuttgart. Nach einem Studium in internationaler Kunstgeschichte und Museologie sowie Spanisch in Freiburg, Madrid, Paris und Heidelberg folgte ein Volontariat in München und dort einige Zeit als Online-Redakteurin. Seit 2020 mit viel Begeisterung für Kultur-Themen der Mallorca Zeitung zuständig.u003C/p>",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":387,"epigraphUrl":-1},"115508569",{"updateDate":393,"createDate":394,"releaseDate":395,"lastModifiedDate":-1},["Date","2025-03-21T14:51:53.000Z"],["Date","2025-03-20T12:28:45.000Z"],["Date","2025-03-21T14:47:52.000Z"],"be0c1ae7-9550-3527-bc57-b795d7b221c3","photo",{"accessType":399,"interviewOptions":400,"frontOptions":401,"basicOptions":402,"adsOptions":-1,"premiumOptions":404,"appearanceOptions":405,"countries":406,"notificationOptions":407,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":6,"analyticsOptions":415,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":-1,"sportsOptions":-1},"T_PAY",{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":6,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":403,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":6,"isOpinion":8},"PRINT",{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":408,"isPersistent":8,"appOptions":409,"webOptions":411,"title":413,"body":414},1440,{"sendPush":8,"notificationButtons":410},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":412},[],"Der Art Palma Brunch ist angerichtet: Ein Programmüberblick ","Die Galerien der Insel sind endgültig aus dem Winterschlaf erwacht: Am Samstag, den 22. März, findet von 11 bis 15 Uhr die bereits 20. Ausgabe des beliebten Art Palma Brunch statt",{"origin":-1,"type":-1,"editor":416,"category":-1,"agencies":417,"adsTypes":418},"redactor_bot",[],[],[420,437,449,455,465,476,486,497],{"width":336,"url":421,"height":422,"quality":64,"childPhotoClippings":423,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_alta-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","750",[424,431],{"width":425,"url":426,"height":427,"quality":428,"childPhotoClippings":429,"type":430,"cropped":8},"640","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_alta-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","400","alta-libre-aspect-ratio",[],"custom",{"width":432,"url":433,"height":434,"quality":428,"childPhotoClippings":435,"type":430,"cropped":8},"320","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_alta-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","200",[],"original",{"width":438,"url":439,"height":440,"quality":67,"childPhotoClippings":441,"type":436,"cropped":8},"660","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","413",[442,446],{"width":425,"url":443,"height":427,"quality":444,"childPhotoClippings":445,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","media-libre-aspect-ratio",[],{"width":432,"url":447,"height":434,"quality":444,"childPhotoClippings":448,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":450,"url":451,"height":452,"quality":453,"childPhotoClippings":454,"type":436,"cropped":8},"300","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_baja-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","188","baja_libre_clipping",[],{"width":456,"url":457,"height":458,"quality":459,"childPhotoClippings":460,"type":436,"cropped":8},"420","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_mobile-ep-aspect-ratio_default_0.jpg","263","mobile_ep_clipping",[461],{"width":432,"url":462,"height":434,"quality":463,"childPhotoClippings":464,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_mobile-ep-aspect-ratio_320w_0.jpg","mobile-ep-aspect-ratio",[],{"width":425,"url":466,"height":427,"quality":467,"childPhotoClippings":468,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_mobile-sp-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","mobile_sp_libre_clipping",[469,473],{"width":425,"url":470,"height":427,"quality":471,"childPhotoClippings":472,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_mobile-sp-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","mobile-sp-libre-aspect-ratio",[],{"width":432,"url":474,"height":434,"quality":471,"childPhotoClippings":475,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_mobile-sp-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":477,"url":478,"height":479,"quality":480,"childPhotoClippings":481,"type":436,"cropped":8},"388","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_portada-ep-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","243","portada_ep_libre_clipping",[482],{"width":432,"url":483,"height":434,"quality":484,"childPhotoClippings":485,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_portada-ep-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","portada-ep-libre-aspect-ratio",[],{"width":487,"url":488,"height":425,"quality":436,"childPhotoClippings":489,"type":436,"cropped":8},"1024","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_original-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[490,494],{"width":425,"url":491,"height":427,"quality":492,"childPhotoClippings":493,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_original-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","original-libre-aspect-ratio",[],{"width":432,"url":495,"height":434,"quality":492,"childPhotoClippings":496,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_original-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":498,"url":499,"height":500,"quality":501,"childPhotoClippings":502,"type":430,"cropped":8},"880","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg","495","16_9_large",[503,507],{"width":425,"url":504,"height":505,"quality":67,"childPhotoClippings":506,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_16-9-aspect-ratio_640w_0.jpg","360",[],{"width":432,"url":508,"height":509,"quality":67,"childPhotoClippings":510,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/d2cef7e2-9997-44f9-ae48-c311e6424f3d_16-9-aspect-ratio_320w_0.jpg","180",[],[512,518,523],{"name":513,"id":514,"originalId":515,"title":513,"url":516,"urls":517,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":6},"Kunst","4f2ae4a4-3fe4-3bec-9081-5d6b146a066e","REGIONALES_1588764","/kultur/kunst/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":516,"epigraphUrl":-1},{"name":352,"id":519,"originalId":520,"title":352,"url":521,"urls":522,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":6},"860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca","REGIONALES_1588766","https://www.mallorcazeitung.es/kultur/ausstellungen/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":521,"epigraphUrl":-1},{"name":524,"id":525,"originalId":526,"title":524,"url":527,"urls":528,"childUrl":-1,"parentUrl":-1,"active":6},"Kultur","419cc8e2-d536-391a-b441-00705fb40581","REGIONALES_28003","https://www.mallorcazeitung.es/kultur/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":527,"epigraphUrl":-1},[530,536,542,547,553,558,563,569,575,581,586],{"name":531,"id":532,"originalId":533,"title":531,"url":534,"urls":535,"active":6},"kunstler","23d92422-90d6-3b55-806b-71813cbf8f15","REGIONALES_1584306","https://www.mallorcazeitung.es/tags/kunstler/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":534,"epigraphUrl":-1},{"name":537,"id":538,"originalId":539,"title":537,"url":540,"urls":541,"active":6},"Galerien","8ca864a5-0687-319a-8986-032bd0e79268","REGIONALES_1583501","/tags/galerien/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":540,"epigraphUrl":-1},{"name":513,"id":543,"originalId":544,"title":513,"url":545,"urls":546,"active":6},"918e8178-8e4f-33ff-90d5-83c228882d16","REGIONALES_1584301","https://www.mallorcazeitung.es/tag/kunst/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":545,"epigraphUrl":-1},{"name":548,"id":549,"originalId":550,"title":548,"url":551,"urls":552,"active":6},"Malerei","0279abaa-9dd9-35f4-9ec1-ffdb2f76bd9f","REGIONALES_1584537","/tags/malerei/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":551,"epigraphUrl":-1},{"name":352,"id":554,"originalId":555,"title":352,"url":556,"urls":557,"active":6},"5b529a99-734b-3f27-8e85-a9e794c1c800","REGIONALES_1582350","https://www.mallorcazeitung.es/tag/ausstellungen/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":556,"epigraphUrl":-1},{"name":524,"id":559,"originalId":560,"title":524,"url":561,"urls":562,"active":6},"d21070e1-5833-3ff3-a12c-f36222fc8e6e","REGIONALES_1584292","/tags/kultur/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":561,"epigraphUrl":-1},{"name":564,"id":565,"originalId":566,"title":564,"url":567,"urls":568,"active":6},"Art Palma Brunch","84c3cee3-de20-3515-aa47-34c061616c5e","REGIONALES_1582295","https://www.mallorcazeitung.es/tags/art-palma-brunch/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":567,"epigraphUrl":-1},{"name":570,"id":571,"originalId":572,"title":570,"url":573,"urls":574,"active":6},"zeitgenössische Kunst","72021555-ba8d-38e8-8bf7-a960c054eeed","REGIONALES_1586750","/tags/zeitgenoessische-kunst/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":573,"epigraphUrl":-1},{"name":576,"id":577,"originalId":578,"title":576,"url":579,"urls":580,"active":6},"Events","a7893335-1476-3517-a329-0a1a1b1be05d","REGIONALES_1583240","/tags/events/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":579,"epigraphUrl":-1},{"name":27,"id":582,"originalId":583,"title":27,"url":584,"urls":585,"active":6},"c019de22-6af6-3220-aea4-50409080c6cb","REGIONALES_1584540","https://www.mallorcazeitung.es/tags/mallorca/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":584,"epigraphUrl":-1},{"name":587,"id":588,"originalId":589,"title":587,"url":590,"urls":591,"active":6},"Palma","9c8e70eb-871e-3737-95e7-5ca967571ced","REGIONALES_1598137","https://www.mallorcazeitung.es/tags/palma/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":590,"epigraphUrl":-1},[],"Der Art Palma Brunch ist angerichtet: Ein Programmüberblick für das Frühlingsevent der Kunst auf Mallorca","https://www.mallorcazeitung.es/kultur/kunst/2025/03/21/art-palma-brunch-programm-115508569.html",{"mainUrl":594,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},0,{"data":598,"type":379},"u003Cp class="ft-text">Und u003Cstrong>Peter Halley u003C/strong>(New York, 1953), der nun mit einer Retrospektive im Casal Solleric geehrt wird, war es, der bei diesem Kult ausscherte und „um die Ecke dachte“. Im Grunde genommen ein Querdenker, bevor dieser Begriff im Zuge der Pandemie einen Beigeschmack bekam. Tatsächlich hat seine Kunst aber sogar einen Lockdown-Bezug: „Halley u003Cstrong>sah das Quadrat auf eine andere Weise: als Grundeinheit der Begrenzung, der räumlichen Isolationu003C/strong>u003Cem>. u003C/em>Und dagegen rebellierte er mit einer respektlosen, ikonoklastischen Geste“, schreibt Solana.u003C/p>",{"data":600,"type":603},{"level":601,"text":602,"indent":-1,"align":-1},"h2","Gefängnisse und fensterlose Zellen","heading",{"data":605,"type":379},"u003Cp class="ft-text">Zur Erläuterung wählt er den folgenden Vergleich: So wie Marcel Duchamp einst einer Reproduktion der Mona Lisa einen Schnurrbart und Spitzbart verpasst hatte, malte Peter Halley u003Cstrong>vertikale Streifen ins Innere des Quadrats u003C/strong>und verwandelte es somit in das vergitterte Fenster, u003Cstrong>das Gefängnis:u003C/strong> seine erste Ikone. Dann nahm er sich das Quadrat erneut zur Brust, füllte es mit einer strukturierten Tupfung und schuf eine zweite Ikone: dieu003Cstrong> fensterlose Zelle. u003C/strong>In Halleys Gemälden werden diese beiden Ikonen durch Schächte und Schornsteine ergänzt, sodass eine schematische, klaustrophobische Architektur entsteht.u003C/p>",{"data":607,"type":379},"u003Cp class="ft-text">Das wirklich Radikale und Besondere dabei ist aber, dass der seit den frühen 1980ern aktive Künstler u003Cstrong>der Geometrie eine neue Bedeutungsebeneu003C/strong> gab, die darüber hinausgeht, auf konkrete und bekannte Formen anzuspielen: Seine Werke illustrieren die u003Cstrong>Strukturen, die unser Handeln in der heutigen Gesellschaft bestimmenu003C/strong>. Halley wehrte sich stets gegen das Etikett „Abstrakte Kunst“. Vielmehr sollten seine Arbeiten auf u003Cem>diagrammatischeu003C/em> Art und Weise die Steuerungsvorgänge des modernen Lebens repräsentieren: einer post-industriellen, elektronischen, digitalen und oft geometrisch geordneten Welt.u003C/p>",{"data":609,"type":603},{"level":601,"text":610,"indent":-1,"align":-1},"Gegen die "Geometrisierung" des Lebens",{"data":612,"type":379},"u003Cp class="ft-text">Für die klassischen Künstler der Abstraktion im 20. Jahrhundert verkörperte die Geometrie ein erstrebenswertes u003Cstrong>Ideal von Reinheit, Ordnung und Vernunftu003C/strong>. Bei Halley hingegen bekommt sie etwas Dystopisches: Er betrachtet sie als u003Cstrong>Sprache der Unternehmens- und Verwaltungsweltu003C/strong>, der Stadtplanung und der Telekommunikation. So prangert er in den Essays, von denen er zahlreiche im Laufe seiner Karriere schrieb, die „Geometrisierung“ unseres Lebens an.u003C/p>",{"data":614,"type":379},"u003Cp class="ft-text">Und das schon zu einer Zeit, die noch weitgehend analog funktionierte. Deru003Cstrong> Einzug neuer Technologienu003C/strong> in unsere Lebensrealität, die von Isolierung und permanenter Vernetzung zugleich geprägt ist, findet bei Halley Niederschlag in eineru003Cstrong> fluoreszierenden Farbpaletteu003C/strong>, die die Energie von Bildschirmen heraufbeschwört. In seinen neueren Kompositionen durchbricht die freie, schwebende Bewegung der Elemente das Format der Leinwand. Solana schreibt: „In diesenu003Cem> shaped canvasesu003C/em>, die einem Tanz von Quadraten und Rechtecken gleichen,u003Cstrong> befreit sich Halley auf wundersame Weise vom Quadrat als Gefängnisu003C/strong>.“u003C/p>",{"data":616,"type":397},{"photoView":617,"footer":-1,"author":-1,"imageSrc":-1,"id":693,"type":397,"preTitle":-1,"metas":618,"photoFooter":620,"signature":621,"shortPreTitle":-1,"alt":-1,"photoId":623,"description":-1,"shortDescription":-1,"shortTitle":-1,"published":6,"title":624,"photoClippings":625,"url":680,"body":-1,"shoppingInfo":-1,"bodyComponents":695},{"preTitle":-1,"metas":618,"photoFooter":620,"signature":621,"shortPreTitle":-1,"alt":-1,"photoId":623,"description":-1,"shortDescription":-1,"shortTitle":-1,"published":6,"title":624,"photoClippings":625,"url":680,"id":693,"type":397,"body":-1,"shoppingInfo":-1,"bodyComponents":694},{"metaKeywords":-1,"customMetas":619,"metaTitle":-1,"metaCanonicalURL":-1,"metaDescription":-1,"metaRobots":371},[],"u003Cp>Peter Halley (Mitte) mit Fernando Gómez de la Cuesta (li.) und Kulturstadtrat Javier Bonet.u003C/p>",{"name":622,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Rathaus Palma","115515992","Peter Halley (Mitte) mit Fernando Gómez de la Cuesta (li.) und Kulturstadtrat Javier Bonet.",[626,638,647,654,661,671,678],{"width":336,"url":627,"height":628,"quality":64,"childPhotoClippings":629,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_alta-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","1600",[630,634],{"width":631,"url":632,"height":425,"quality":428,"childPhotoClippings":633,"type":430,"cropped":8},"480","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_alta-libre-aspect-ratio_640h_0.jpg",[],{"width":635,"url":636,"height":432,"quality":428,"childPhotoClippings":637,"type":430,"cropped":8},"240","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_alta-libre-aspect-ratio_320h_0.jpg",[],{"width":438,"url":639,"height":498,"quality":67,"childPhotoClippings":640,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[641,644],{"width":631,"url":642,"height":425,"quality":444,"childPhotoClippings":643,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_media-libre-aspect-ratio_640h_0.jpg",[],{"width":635,"url":645,"height":432,"quality":444,"childPhotoClippings":646,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_media-libre-aspect-ratio_320h_0.jpg",[],{"width":450,"url":648,"height":427,"quality":453,"childPhotoClippings":649,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_baja-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[650],{"width":635,"url":651,"height":432,"quality":652,"childPhotoClippings":653,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_baja-libre-aspect-ratio_320h_0.jpg","baja-libre-aspect-ratio",[],{"width":456,"url":655,"height":656,"quality":459,"childPhotoClippings":657,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_mobile-ep-aspect-ratio_default_0.jpg","560",[658],{"width":635,"url":659,"height":432,"quality":463,"childPhotoClippings":660,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_mobile-ep-aspect-ratio_320h_0.jpg",[],{"width":425,"url":662,"height":663,"quality":467,"childPhotoClippings":664,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_mobile-sp-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","853",[665,668],{"width":631,"url":666,"height":425,"quality":471,"childPhotoClippings":667,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_mobile-sp-libre-aspect-ratio_640h_0.jpg",[],{"width":635,"url":669,"height":432,"quality":471,"childPhotoClippings":670,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_mobile-sp-libre-aspect-ratio_320h_0.jpg",[],{"width":477,"url":672,"height":673,"quality":480,"childPhotoClippings":674,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_portada-ep-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","517",[675],{"width":635,"url":676,"height":432,"quality":484,"childPhotoClippings":677,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_portada-ep-libre-aspect-ratio_320h_0.jpg",[],{"width":679,"url":680,"height":681,"quality":436,"childPhotoClippings":682,"type":430,"cropped":8},"1500.0","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_source-aspect-ratio_default_0.jpg","2000.0",[683,688],{"width":684,"url":685,"height":686,"quality":67,"childPhotoClippings":687,"type":430,"cropped":8},"480.0","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_source-aspect-ratio_640h_0.jpg","640.0",[],{"width":689,"url":690,"height":691,"quality":67,"childPhotoClippings":692,"type":430,"cropped":8},"240.0","https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/035cd8c2-fbcb-4380-9ef9-4c29a75db0c7_source-aspect-ratio_320h_0.jpg","320.0",[],"23c4cca9-c9da-3acf-b832-37f0e39d2d9a",[],[],{"data":697,"type":603},{"level":601,"text":698,"indent":-1,"align":-1},"Erste Retrospektive in Spanien seit 1992",{"data":700,"type":379},"u003Cp class="ft-text">Seit Mitte der 1990er schuf der US-Amerikaner, dessen Arbeiten sich unter anderem im Museum of Modern Art, der Tate Gallery und der Sammlung des Guggenheim Museums befinden, auchu003Cstrong> ortsspezifische Installationenu003C/strong>. Dieser Teil seiner Aktivität bleibt auf Wunsch des Künstlers aber bei der Ausstellung in Palma außen vor; sie befasst sich nur mit der Entwicklung seiner Malerei.u003C/p>",{"data":702,"type":379},"u003Cp class="ft-text">Halley wählte auch persönlich die 20 gezeigten Arbeiten aus, die im u003Cstrong>Zeitraum von 1985 bis 2024u003C/strong> entstanden. Sie stammen aus privaten und öffentlichen spanischen Sammlungen. Bei der Schau handelt es sich um die erste Retrospektive in u003Ca class="ft-link ft-link--decoration" href="/tags/spanien/" target="_blank">Spanien u003C/a>seit 1992, und um eine Kooperation mit dem u003Cstrong>Museo Thyssen-Bornemisza in Madridu003C/strong>. Dort war sie bis zum 19. Januar vor der zweiten Station in Palma zu sehen.u003C/p>",{"data":704,"type":379},"u003Cp class="ft-text">u003Cem>„Peter Halley en España“, 22. März, 12 Uhr, bis 25. Mai, Casal Solleric, Passeig del Born, 27, Eintritt frei.u003C/em>u003C/p>",[],[707],{"type":708,"data":709},"subtitle-tag",{"text":330,"level":601},[],{"twitterInformation":712,"facebookInformation":713},{"title":327,"url":333},{"title":327,"url":333},"peter,halley,casal,solleric",{"updateDate":716,"createDate":717,"releaseDate":718,"lastModifiedDate":-1},["Date","2025-03-21T14:53:37.000Z"],["Date","2025-03-20T12:28:38.000Z"],["Date","2025-03-21T14:48:28.000Z"],[720],{"preTitle":-1,"metas":721,"photoFooter":-1,"signature":723,"shortPreTitle":-1,"alt":-1,"photoId":725,"description":-1,"shortDescription":-1,"shortTitle":-1,"published":6,"title":726,"photoClippings":727,"url":796,"id":797,"type":397,"body":-1,"shoppingInfo":-1,"bodyComponents":798},{"metaKeywords":-1,"customMetas":722,"metaTitle":-1,"metaCanonicalURL":-1,"metaDescription":-1,"metaRobots":371},[],{"name":724,"place":-1,"source":-1,"authorText":-1},"Casal Solleric","115516050",""The World is Not Enough" und "Faith Force" von Peter Halley.",[728,740,750,754,761,770,777,787],{"width":336,"url":729,"height":730,"quality":64,"childPhotoClippings":731,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_alta-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","678",[732,736],{"width":425,"url":733,"height":734,"quality":428,"childPhotoClippings":735,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_alta-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg","362",[],{"width":432,"url":737,"height":738,"quality":428,"childPhotoClippings":739,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_alta-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg","181",[],{"width":438,"url":741,"height":742,"quality":67,"childPhotoClippings":743,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_media-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","373",[744,747],{"width":425,"url":745,"height":734,"quality":444,"childPhotoClippings":746,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_media-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":432,"url":748,"height":738,"quality":444,"childPhotoClippings":749,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_media-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":450,"url":751,"height":752,"quality":453,"childPhotoClippings":753,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_baja-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","170",[],{"width":456,"url":755,"height":756,"quality":459,"childPhotoClippings":757,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_mobile-ep-aspect-ratio_default_0.jpg","237",[758],{"width":432,"url":759,"height":738,"quality":463,"childPhotoClippings":760,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_mobile-ep-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":425,"url":762,"height":734,"quality":467,"childPhotoClippings":763,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_mobile-sp-libre-aspect-ratio_default_0.jpg",[764,767],{"width":425,"url":765,"height":734,"quality":471,"childPhotoClippings":766,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_mobile-sp-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":432,"url":768,"height":738,"quality":471,"childPhotoClippings":769,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_mobile-sp-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":477,"url":771,"height":772,"quality":480,"childPhotoClippings":773,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_portada-ep-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","219",[774],{"width":432,"url":775,"height":738,"quality":484,"childPhotoClippings":776,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_portada-ep-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":487,"url":778,"height":779,"quality":436,"childPhotoClippings":780,"type":436,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_original-libre-aspect-ratio_default_0.jpg","579",[781,784],{"width":425,"url":782,"height":734,"quality":492,"childPhotoClippings":783,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_original-libre-aspect-ratio_640w_0.jpg",[],{"width":432,"url":785,"height":738,"quality":492,"childPhotoClippings":786,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_original-libre-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],{"width":336,"url":333,"height":339,"quality":66,"childPhotoClippings":788,"type":430,"cropped":8},[789,793],{"width":425,"url":790,"height":505,"quality":791,"childPhotoClippings":792,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_16-9-discover-aspect-ratio_640w_0.jpg","16-9-discover-aspect-ratio",[],{"width":432,"url":794,"height":509,"quality":791,"childPhotoClippings":795,"type":430,"cropped":8},"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_16-9-discover-aspect-ratio_320w_0.jpg",[],"https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/8e3ac64e-215b-4a50-904f-b7e903a27371_source-aspect-ratio_default_0.jpg","8f06551e-1f35-3b41-908a-70004857dedb",[],[800,804,807],{"name":352,"id":519,"originalId":520,"title":352,"url":521,"urls":801,"childUrl":802,"parentUrl":803,"active":6},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":521,"epigraphUrl":-1},"/ausstellungen","/kultur",{"name":513,"id":514,"originalId":515,"title":513,"url":516,"urls":805,"childUrl":806,"parentUrl":803,"active":6},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":516,"epigraphUrl":-1},"/kunst",{"name":524,"id":525,"originalId":526,"title":524,"url":527,"urls":808,"childUrl":803,"parentUrl":-1,"active":6},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":527,"epigraphUrl":-1},[810,812,814,820,825,827,829,831],{"name":531,"id":532,"originalId":533,"title":531,"url":534,"urls":811,"active":6},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":534,"epigraphUrl":-1},{"name":513,"id":543,"originalId":544,"title":513,"url":545,"urls":813,"active":6},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":545,"epigraphUrl":-1},{"name":815,"id":816,"originalId":817,"title":815,"url":818,"urls":819,"active":6},"Madrid","a16d782a-14e0-3c5b-807c-d8e7019993c0","REGIONALES_1584516","https://www.mallorcazeitung.es/tags/madrid/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":818,"epigraphUrl":-1},{"name":724,"id":821,"originalId":822,"title":724,"url":823,"urls":824,"active":6},"aa4b2217-8233-3e2f-9b5f-e6f32402e3df","REGIONALES_1582802","https://www.mallorcazeitung.es/tags/casal-solleric/",{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":823,"epigraphUrl":-1},{"name":587,"id":588,"originalId":589,"title":587,"url":590,"urls":826,"active":6},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":590,"epigraphUrl":-1},{"name":27,"id":582,"originalId":583,"title":27,"url":584,"urls":828,"active":6},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":584,"epigraphUrl":-1},{"name":352,"id":554,"originalId":555,"title":352,"url":556,"urls":830,"active":6},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":556,"epigraphUrl":-1},{"name":564,"id":565,"originalId":566,"title":564,"url":567,"urls":832,"active":6},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":567,"epigraphUrl":-1},[],{"mainUrl":17,"epigraphUrl":-1,"redirectUrl":-1,"sourceUrl":-1},{"accessType":399,"interviewOptions":836,"frontOptions":837,"basicOptions":838,"adsOptions":839,"premiumOptions":1246,"appearanceOptions":1247,"countries":1248,"notificationOptions":1249,"type":-1,"editionType":-1,"redirectFollow":6,"analyticsOptions":1255,"communityOptions":-1,"freeformHtmls":1259,"sportsOptions":-1},{"interviewKicker":-1,"intervieweeRole":-1,"isInterview":8,"interviewee":-1},{"showLiveIcon":8,"excludeFromAutomaticModules":-1,"hideColumnistStyle":8,"showVideoIcon":8,"showPhotoGalleryIcon":8,"showImageSignature":8,"specialKicker":-1,"showSignature":6,"hidePhoto":8,"hideMediaReportStyle":8,"titleSize":-1,"showPlace":8,"showPreTitle":8},{"appearanceHideRelations":8,"disablePageRefresh":8,"appearanceHideInTagListings":8,"denyComments":8,"doNotGenerateAmpVersion":8,"oldContent":8,"sourceIsAgency":8,"hideInLastContents":8,"hideInTagPages":8,"hideInMostViewed":8,"hideInAllListings":8,"source":403,"disableAmp":8,"cxenseEnabled":6,"isOpinion":8},{"disableAdvertising":8,"disableNonDfpAdvertising":8,"explicitContent":8,"disableAdvertisingInPhotos":8,"adMaps":840,"adUnits":1238,"vastUrls":1242,"adScheduleVideo":1244,"networkCode":1245},{"main":841,"amp":1002,"premium":1094,"premiumAmp":1200,"articleAmp":-1,"content":-1,"contentPremium":-1},{"name":842,"positions":843,"id":999,"published":6,"typeAlias":1000,"config":1001,"adMapId":913},"all - web - noticia",{"footer":844,"pageStealers":-1,"columns":876,"htmls":931,"header":941,"skies":964,"repeatPattern":-1,"banners":-1},[845],{"data":846,"name":869,"id":870,"published":6,"typeAlias":871,"config":872,"adPositionId":874,"slotBitMask":875},{"targeting":847,"mapping":851,"sizes":867,"slot":849,"type":868},[848],{"value":849,"key":850},"cpm_fmega","p",[852,855,858,861,864],{"value":853,"key":854},"[[1,1],[728,90],[980,90],[990,90],[970,90],[990,45],[990,50],[980,45],[980,50],[970,50]]","[990,0]",{"value":856,"key":857},"[[1,1],[728,90],[980,90],[970,90],[980,45],[980,50],[970,50]]","[980,0]",{"value":859,"key":860},"[[1,1],[728,90],[970,90],[970,50]]","[970,0]",{"value":862,"key":863},"[[1,1],[728,90],[320,50],[320,53],[320,100]]","[728,0]",{"value":865,"key":866},"[[1,1],[320,50],[320,53],[320,100],"fluid"]","[0,0]","[[1, 1]]","local","all - web - cpm_fmega","5b117aeb-6c14-3642-82d7-a36956ca3fbc","adserverAdPosition",{"delay":6,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":596,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":6,"enabledForBitMask":873},7,"1000019","cpm_fmega-7",{"right":877},[878,899,915],{"data":879,"name":891,"id":892,"published":6,"typeAlias":871,"config":893,"adPositionId":897,"slotBitMask":898},{"targeting":880,"mapping":883,"sizes":867,"slot":889,"type":890},[881],{"value":882,"key":850},"cpm_r_dcha",[884,887],{"value":885,"key":886},"[[1,1],[300,250],[300,300],[300,600],"fluid"]","[768,0]",{"value":888,"key":866},"[[1,1],[300,600],[336,280],[320,480],[300,250],[300,300],[250,250],[300,100],"fluid"]","300dcha","nacional","all - web - cpm_r_dcha","d51e6032-66d7-3fc8-984f-e07e21b44627",{"delay":8,"locationMobile":894,"orderMobile":895,"lazyLoad":8,"order":896,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":6,"enabledForBitMask":873},"Bajo párrafo del cuerpo",2,1,"1000004","300dcha-7",{"data":900,"name":908,"id":909,"published":6,"typeAlias":871,"config":910,"adPositionId":913,"slotBitMask":914},{"targeting":901,"mapping":904,"sizes":867,"slot":907,"type":868},[902],{"value":903,"key":850},"cpm_r_dchab",[905,906],{"value":885,"key":886},{"value":888,"key":866},"300dchab","all - web - cpm_r_dchab","de5b8131-a464-315a-aeee-41406df6606d",{"delay":8,"locationMobile":894,"orderMobile":911,"lazyLoad":8,"order":912,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":6,"enabledForBitMask":873},6,3,"1000005","300dchab-7",{"data":916,"name":924,"id":925,"published":6,"typeAlias":871,"config":926,"adPositionId":929,"slotBitMask":930},{"targeting":917,"mapping":920,"sizes":867,"slot":923,"type":890},[918],{"value":919,"key":850},"cpm_r_dchac",[921,922],{"value":885,"key":886},{"value":888,"key":866},"300dchac","all - web - cpm_r_dchac","bed06774-7bf1-30ce-b3eb-146d1f1f2f96",{"delay":8,"locationMobile":894,"orderMobile":927,"lazyLoad":6,"order":928,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":912},11,5,"1000009","300dchac-3",{"head":932},[933],{"data":934,"name":936,"id":937,"published":6,"typeAlias":938,"config":939,"adPositionId":940,"slotBitMask":-1},{"html":935},"u003Cstyle>n .article__video-news__aperture>.new {n max-width: 100%;n margin-left: 0;n width: 100%;n }nu003C/style>","css fix videos","6f3d6dd9-fb2a-3cee-8b7b-057d1504ff39","htmlAdPosition",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":596,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":6,"enabledForBitMask":873},"1000024",[942],{"data":943,"name":959,"id":960,"published":6,"typeAlias":871,"config":961,"adPositionId":962,"slotBitMask":963},{"targeting":944,"mapping":947,"sizes":867,"slot":958,"type":890},[945],{"value":946,"key":850},"cpm_m",[948,950,952,954,956],{"value":949,"key":854},"[[1,1],[728,90],[980,90],[980,180],[728,250],[990,90],[980,200],[980,250],[990,200],[990,250],[970,90],[970,250],[990,45],[990,50],[980,45],[980,50],"fluid"]",{"value":951,"key":857},"[[1,1],[728,90],[980,90],[980,180],[728,250],[980,200],[980,250],[970,90],[970,250],[980,45],[980,50],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],"fluid"]",{"value":953,"key":860},"[[1,1],[728,90],[728,250],[970,90],[970,250],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],"fluid"]",{"value":955,"key":863},"[[1,1],[728,90],[728,250],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],"fluid"]",{"value":957,"key":866},"[[1,1],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],"fluid"]","728","all - web - cpm_m","0b8fc971-2947-3e7b-bee9-8a0492fb7691",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":596,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":6,"enabledForBitMask":873},"1000001","728-7",{"left":965,"right":983},[966],{"data":967,"name":978,"id":979,"published":6,"typeAlias":871,"config":980,"adPositionId":981,"slotBitMask":982},{"targeting":968,"mapping":971,"sizes":867,"slot":977,"type":890},[969],{"value":970,"key":850},"cpm_si",[972,975],{"value":973,"key":974},"[[1,1],[120,600],[120,1000],[160,1000],[160,600],[450,1000]]","[1280,0]",{"value":976,"key":866},"[]","skyizda","all - web - cpm_si","658f0c87-3469-3156-aad2-190bdc40b22d",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":596,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":912},"1000002","skyizda-3",[984],{"data":985,"name":994,"id":995,"published":6,"typeAlias":871,"config":996,"adPositionId":997,"slotBitMask":998},{"targeting":986,"mapping":989,"sizes":867,"slot":993,"type":890},[987],{"value":988,"key":850},"cpm_sd",[990,992],{"value":991,"key":974},"[[1,1],[120,601],[120,1001],[160,1001],[160,601],[450,1001]]",{"value":976,"key":866},"skydcha","all - web - cpm_sd","ce904dfc-3f41-3577-814f-fc932949883c",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":596,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":912},"1000003","skydcha-3","4933c8ca-4304-34fb-966e-32f3fb672260","adMapContent",{"lazyLoadSensibilityDesktop":896,"headScripts":-1,"customStyles":-1,"lazyLoadSensibilityMobile":895},{"name":1003,"positions":1004,"id":1088,"published":6,"typeAlias":1089,"config":1090,"adMapId":1093},"mz - amp - noticia free",{"footer":1005,"pageStealers":1015,"columns":-1,"htmls":1062,"header":1070,"skies":-1,"repeatPattern":-1,"banners":1079},[1006],{"data":1007,"name":1011,"id":1012,"published":6,"typeAlias":1013,"config":-1,"adPositionId":1014,"slotBitMask":-1},{"targeting":1008,"html":1010,"type":868},[1009],{"value":849,"key":850},"u003Cdiv id="sticky-container">nu003Camp-sticky-ad layout="nodisplay" next-page-replace="sticky">u003Camp-ad data-force-safeframe="true"n data-block-on-consent="_till_responded" width="320" height="100" class="ad-slot" type="doubleclick"n data-slot="/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]" json='{"targeting":{"KEY":"VALUE"[TARGETING-TAGEPI]}}'n rtc-config='{"urls":["https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150"],"vendors":{"criteo":{"NETWORK_ID": "5100","PUBLISHER_SUB_ID":"cpm_fmega"},"aps":{"PUB_ID": "3471","PARAMS":{"amp":"1"}},"indexexchange": {"SITE_ID" : "793973"},"richaudience": {"PLACEMENT_ID": "j7L7pTlrCP"}}}'n layout="fixed" data-multi-size="320x53,320x50,300x100,300x50,300x53,fluid"n data-multi-size-validation="false">u003C/amp-ad>u003C/amp-sticky-ad>nu003C/div>","mz - amp - cpm_fmega (scroll infinito)","626eee2d-cf3f-3e64-be7f-4803f01cf084","adserverAmpAdPosition","1000192",{"all":1016,"simple":1061},[1017,1026,1034,1043,1051],{"data":1018,"name":1022,"id":1023,"published":6,"typeAlias":1013,"config":1024,"adPositionId":1025,"slotBitMask":-1},{"targeting":1019,"html":1021,"type":890},[1020],{"value":882,"key":850},"u003Ccenter>u003Camp-ad data-force-safeframe="true" data-block-on-consent="_till_responded" width="336" height="600"n class="ad-slot" type="doubleclick" data-slot="/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]"n json='{"targeting":{"KEY":"VALUE"[TARGETING-TAGEPI]}}'n rtc-config='{"urls": ["https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150"], "vendors":{"criteo":{"NETWORK_ID": "5100","PUBLISHER_SUB_ID":"cpm_r_dcha"},"aps":{"PUB_ID": "3471","PARAMS":{"amp":"1"}},"indexexchange": {"SITE_ID" : "793973"},"richaudience": {"PLACEMENT_ID": "Uz8ewOvzCf"}}}'n layout="fixed" data-multi-size="300x600,336x280,320x480,300x300,300x250,250x250,fluid"n data-multi-size-validation="false">u003C/amp-ad>u003C/center>","mz - amp - cpm_r_dcha","2a6872ea-3c41-30fd-9801-020fcfbdc9e3",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":895,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":596},"1000142",{"data":1027,"name":1029,"id":1030,"published":6,"typeAlias":1013,"config":1031,"adPositionId":1033,"slotBitMask":-1},{"html":1028,"type":890},"u003Camp-ad width="4" height="3" type="sunmedia" layout="responsive" data-cid="07d74c5c-6230-4aed-b6a5-e7b9bbe967df" data-html-access-allowed="true" data-block-on-consent="_till_responded">u003C/amp-ad>","mz - amp - sunmedia","f44bca1b-ca39-317d-ad8f-7fe907d4abd4",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":1032,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":596},4,"1000071",{"data":1035,"name":1039,"id":1040,"published":6,"typeAlias":1013,"config":1041,"adPositionId":1042,"slotBitMask":-1},{"targeting":1036,"html":1038,"type":868},[1037],{"value":903,"key":850},"u003Ccenter>u003Camp-ad data-force-safeframe="true" data-block-on-consent="_till_responded" width="336" height="600"n class="ad-slot" type="doubleclick" data-slot="/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]"n json='{"targeting":{"KEY":"VALUE"[TARGETING-TAGEPI]}}'n rtc-config='{"urls": ["https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150"], "vendors":{"criteo":{"NETWORK_ID": "5100","PUBLISHER_SUB_ID":"cpm_r_dchab"},"aps":{"PUB_ID": "3471","PARAMS":{"amp":"1"}},"indexexchange": {"SITE_ID" : "793973"},"richaudience": {"PLACEMENT_ID": "rzwEkwGPSY"}}}'n layout="fixed" data-multi-size="300x600,336x280,320x480,300x300,300x250,250x250,fluid"n data-multi-size-validation="false">u003C/amp-ad>u003C/center>","mz - amp - cpm_r_dchab","a5f15238-8f90-3d67-9032-6e13ee07d4d1",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":873,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":596},"1000158",{"data":1044,"name":1046,"id":1047,"published":6,"typeAlias":1013,"config":1048,"adPositionId":1050,"slotBitMask":-1},{"html":1045,"type":890},"u003Camp-ad width="1" height="1" type="sunmedia" layout="responsive" data-cid="8a374dd3-bf18-43ee-bea3-b43e82d74f8e" data-html-access-allowed="true" data-block-on-consent="_till_responded">u003C/amp-ad>","mz - amp - sunmedia2","f84341f2-bff3-3b5b-9fc2-afa6e1f4a2aa",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":1049,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":596},10,"1000078",{"data":1052,"name":1056,"id":1057,"published":6,"typeAlias":1013,"config":1058,"adPositionId":1060,"slotBitMask":-1},{"targeting":1053,"html":1055,"type":890},[1054],{"value":919,"key":850},"u003Ccenter>u003Camp-ad data-lazy-fetch="true" data-loading-strategy="prefer-viewability-over-views" data-force-safeframe="true" n data-block-on-consent="_till_responded" width="336" height="600" class="ad-slot" type="doubleclick"n data-slot="/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]" json='{"targeting":{"KEY":"VALUE"[TARGETING-TAGEPI]}}'n rtc-config='{"urls": ["https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150"], "vendors":{"criteo":{"NETWORK_ID": "5100","PUBLISHER_SUB_ID":"cpm_r_dchac"},"aps":{"PUB_ID": "3471","PARAMS":{"amp":"1"}},"indexexchange": {"SITE_ID" : "793973"},"richaudience": {"PLACEMENT_ID": "6huL9YSPuC"}}}'n layout="fixed" data-multi-size="300x600,336x280,320x480,300x300,300x250,250x250,fluid"n data-multi-size-validation="false">u003C/amp-ad>u003C/center>","mz - amp - cpm_r_dchac","de24da8f-beac-36c5-8a5d-d38f6a3fab72",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":1059,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":596},13,"1000174",[],{"bodyStart":1063},[1064],{"data":1065,"name":1067,"id":1068,"published":6,"typeAlias":938,"config":-1,"adPositionId":1069,"slotBitMask":-1},{"html":1066},"u003Camp-iframe width="auto" title="User Sync" height=1 layout="fixed-height" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" frameborder="0" class="sync-ad-pixel iframe-pixel-richaudience" src="https://sync.richaudience.com/3a786fc1b019f44a8b7d3e216dc4ac53/">u003Camp-img layout="fill" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" placeholder>u003C/amp-img>u003C/amp-iframe>nu003C!-- interstitial adgage -->nu003Camp-list id="adk-interstitial-list" [class]="closeInterstitialStickyAd" layout="fill" data-block-on-consent="_till_responded" src="https://loremipsum.adkaora.space/super?source_url=SOURCE_URL&doc_host=AMPDOC_HOST&doc_hostname=AMPDOC_HOSTNAME&doc_url=AMPDOC_URL&canonical_host=CANONICAL_HOST&canonical_hostname=CANONICAL_HOSTNAME&canonical_path=CANONICAL_PATH&canonical_url=CANONICAL_URL&counter=COUNTER&document_charset=DOCUMENT_CHARSET&document_referrer=DOCUMENT_REFERRER&external_referrer=EXTERNAL_REFERRER&html_attr=HTML_ATTR&source_host=SOURCE_HOST&source_hostname=SOURCE_HOSTNAME&source_path=SOURCE_PATH&title=TITLE&viewer=VIEWER">n u003Ctemplate type="amp-mustache">n u003Cdiv id="adk_interstitial">n u003Camp-iframe width="414" height="1027" layout="responsive" id="adk_iframe" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation" resizable frameborder="0" src="{{iframeSrc}}">n u003Cdiv id="interstitialClosingBarSX" overflow on="tap:AMP.setState({closeInterstitialStickyAd:'interstitial closed'})" tabindex="0" role="button">u003C/div>n u003Cdiv id="interstitialClosingBarDX" overflow on="tap:AMP.setState({closeInterstitialStickyAd:'interstitial closed'})" tabindex="0" role="button">u003C/div>n u003Cdiv placeholder>u003C/div>n u003C/amp-iframe>n u003C/div>n u003C/template>nu003C/amp-list>nu003C!-- fin interstitial adgage -->","all - amp - user sync + Adgage","c72c4044-a06f-316e-b588-ccce1b904c4b","1000082",[1071],{"data":1072,"name":1076,"id":1077,"published":6,"typeAlias":1013,"config":-1,"adPositionId":1078,"slotBitMask":-1},{"targeting":1073,"html":1075,"type":890},[1074],{"value":946,"key":850},"u003Camp-ad data-force-safeframe="true" data-block-on-consent="_till_responded" width="320" height="100" class="ad-slot"n type="doubleclick" data-slot="/[NETWORKID]/[TIPO]-[ADUNIT]" json='{"targeting":{"KEY":"VALUE"[TARGETING-TAGEPI]}}'n rtc-config='{"urls":["https://analytics.prensaiberica.es/api/delivery/knowledge?amp=1&id=CLIENT_ID(_mo_id)&aud_limit=150"],"vendors":{"criteo":{"NETWORK_ID": "5100","PUBLISHER_SUB_ID":"cpm_m"},"aps":{"PUB_ID": "3471","PARAMS":{"amp":"1"}},"indexexchange": {"SITE_ID" : "793973"},"richaudience": {"PLACEMENT_ID": "IsG3GjTRVq"}}}'n layout="fixed" data-multi-size="320x53,320x50,300x100,300x50,300x53,fluid"n data-multi-size-validation="false">u003C/amp-ad>","mz - amp - cpm_m","2b3289d6-e58e-353f-8645-683678eb9fe4","1000252",{"underTag":1080},[1081],{"data":1082,"name":1084,"id":1085,"published":6,"typeAlias":1013,"config":1086,"adPositionId":1087,"slotBitMask":-1},{"html":1083,"type":890},"u003Camp-embed width="600" height="600" layout="responsive" type="mgid" data-publisher="mallorcazeitung.es" data-widget="1713767" data-container="M1004121ScriptRootC1713767" data-block-on-consent="_till_responded">u003C/amp-embed>","mz - amp - outbrain taboola mgid native","7ec5f14c-d20e-338e-a8d6-de60f48c5538",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":896,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":596},"1000219","47617f17-0957-3009-a531-525d26432322","adMapAmpArticle",{"lazyLoadSensibilityDesktop":-1,"headScripts":1091,"customStyles":1092,"lazyLoadSensibilityMobile":-1},"u003C!-- etiquetas necesarias para interstitial ADGAGE, también requiere amp-iframe, amp-consent, amp-bind que están incluidas de serie -->nu003Cscript async custom-element="amp-list" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-list-0.1.js" data-type="custom-ads">u003C/script>nu003Cscript async custom-template="amp-mustache" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.2.js" data-type="custom-ads">u003C/script>nu003C!-- fin etiquetas -->",".sync-ad-pixel{margin:0px;padding:0px;}n.site-header .site-header__content{top:0;}namp-ad:not(amp-ad[type="doubleclick"]):before{display:none;}n.ad-container amp-embed+span.ad-signature{display:none;}namp-ad[hidden]+.ad-signature{display:none;}n.ft-ad--roba:has(amp-ad[type="teads"],amp-ad[type="sunmedia"],amp-ad[type="teads"],amp-embed) {min-height: 0;max-width: unset;}n.ft-ad:has(amp-ad[type="teads"],amp-ad[type="sunmedia"],amp-ad[type="teads"],amp-embed)::before {display:none;}nn/* interstitial adgage v3 */n@keyframes setFullPage {0%,95% {transform: translateY(0);height: calc(25vh - 1px);}100% {transform: translateY(-75vh);height: 100vh;}}amp-iframe#adk_iframe[height="363"] {max-width: 100%;max-height: 56vw;min-height: 56vw;transform: scale(0.93);opacity: 1;bottom: 100px;}amp-list#adk-interstitial-list {right: auto;left: 0;top: calc(310vh + 400px);position: absolute;min-height: 1px;width: 100%;}#adk_interstitial amp-iframe,#adk_interstitial amp-iframe[height="1027"] {top: calc(75vh + 1px);z-index: -1;}amp-list#adk-interstitial-list:has(amp-iframe:not([height="1027"])) {z-index: 2147483647;}amp-list#adk-interstitial-list #adk_interstitial amp-iframe[height="1027"] {animation-name: setFullPage;animation-duration: 0.2s;animation-delay: 1s;animation-fill-mode: forwards;}amp-list#adk-interstitial-list.closed {display: none;}#adk_interstitial amp-iframe {position: fixed;bottom: 0;margin: 0;overflow: visible;min-width: 100%;opacity: 0;}#adk_interstitial amp-iframe[height="1024"],#adk_interstitial amp-iframe[height="1025"] {top: 0;max-height: 100%;max-width: 100%;opacity: 1;z-index: 2147483647;}amp-iframe#adk_iframe div#interstitialClosingBarDX,amp-iframe#adk_iframe div#interstitialClosingBarSX {top: 0;z-index: 2147483647;width: 20vw;height: 12.5vh;background: 0 0;visibility: visible;}amp-iframe#adk_iframe[height="363"] #interstitialClosingBarDX,amp-iframe#adk_iframe[height="363"] #interstitialClosingBarSX {z-index: 2147483647;width: 20vw;height: 50px;}amp-iframe#adk_iframe div#interstitialClosingBarSX,amp-iframe#adk_iframe[height="363"] #interstitialClosingBarSX {left: 0;}amp-iframe#adk_iframe div#interstitialClosingBarDX,amp-iframe#adk_iframe[height="363"] #interstitialClosingBarDX {right: 0;}n/* fin interstitial adgage */","1000046",{"name":1095,"positions":1096,"id":1197,"published":6,"typeAlias":1000,"config":1198,"adMapId":1199},"all - web - noticia registrado",{"footer":1097,"pageStealers":-1,"columns":1110,"header":1158,"skies":1171,"repeatPattern":-1,"banners":-1},[1098],{"data":1099,"name":869,"id":870,"published":6,"typeAlias":871,"config":1108,"adPositionId":874,"slotBitMask":1109},{"targeting":1100,"mapping":1102,"sizes":867,"slot":849,"type":868},[1101],{"value":849,"key":850},[1103,1104,1105,1106,1107],{"value":853,"key":854},{"value":856,"key":857},{"value":859,"key":860},{"value":862,"key":863},{"value":865,"key":866},{"delay":6,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":596,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":912},"cpm_fmega-3",{"right":1111},[1112,1121,1131,1140,1149],{"data":1113,"name":891,"id":892,"published":6,"typeAlias":871,"config":1119,"adPositionId":897,"slotBitMask":1120},{"targeting":1114,"mapping":1116,"sizes":867,"slot":889,"type":890},[1115],{"value":882,"key":850},[1117,1118],{"value":885,"key":886},{"value":888,"key":866},{"delay":8,"locationMobile":894,"orderMobile":895,"lazyLoad":8,"order":896,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":895},"300dcha-2",{"data":1122,"name":891,"id":892,"published":6,"typeAlias":871,"config":1128,"adPositionId":897,"slotBitMask":1130},{"targeting":1123,"mapping":1125,"sizes":867,"slot":889,"type":890},[1124],{"value":882,"key":850},[1126,1127],{"value":885,"key":886},{"value":888,"key":866},{"delay":8,"locationMobile":1129,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":896,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":896},"Bajo temas destacados","300dcha-1",{"data":1132,"name":908,"id":909,"published":6,"typeAlias":871,"config":1138,"adPositionId":913,"slotBitMask":1139},{"targeting":1133,"mapping":1135,"sizes":867,"slot":907,"type":868},[1134],{"value":903,"key":850},[1136,1137],{"value":885,"key":886},{"value":888,"key":866},{"delay":8,"locationMobile":894,"orderMobile":911,"lazyLoad":8,"order":912,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":895},"300dchab-2",{"data":1141,"name":908,"id":909,"published":6,"typeAlias":871,"config":1147,"adPositionId":913,"slotBitMask":1148},{"targeting":1142,"mapping":1144,"sizes":867,"slot":907,"type":868},[1143],{"value":903,"key":850},[1145,1146],{"value":885,"key":886},{"value":888,"key":866},{"delay":8,"locationMobile":1129,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":912,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":896},"300dchab-1",{"data":1150,"name":924,"id":925,"published":6,"typeAlias":871,"config":1156,"adPositionId":929,"slotBitMask":1157},{"targeting":1151,"mapping":1153,"sizes":867,"slot":923,"type":890},[1152],{"value":919,"key":850},[1154,1155],{"value":885,"key":886},{"value":888,"key":866},{"delay":8,"locationMobile":894,"orderMobile":927,"lazyLoad":6,"order":928,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":895},"300dchac-2",[1159],{"data":1160,"name":959,"id":960,"published":6,"typeAlias":871,"config":1169,"adPositionId":962,"slotBitMask":1170},{"targeting":1161,"mapping":1163,"sizes":867,"slot":958,"type":890},[1162],{"value":946,"key":850},[1164,1165,1166,1167,1168],{"value":949,"key":854},{"value":951,"key":857},{"value":953,"key":860},{"value":955,"key":863},{"value":957,"key":866},{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":596,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":912},"728-3",{"left":1172,"right":1185},[1173],{"data":1174,"name":1181,"id":1182,"published":6,"typeAlias":871,"config":1183,"adPositionId":1184,"slotBitMask":982},{"targeting":1175,"mapping":1177,"sizes":867,"slot":977,"type":890},[1176],{"value":970,"key":850},[1178,1180],{"value":973,"key":1179},"[1505,0]",{"value":976,"key":866},"all - web - cpm_si (ancho premium)","b00750c2-8010-3aef-8087-4a544279a2be",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":596,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":912},"1000086",[1186],{"data":1187,"name":1193,"id":1194,"published":6,"typeAlias":871,"config":1195,"adPositionId":1196,"slotBitMask":998},{"targeting":1188,"mapping":1190,"sizes":867,"slot":993,"type":890},[1189],{"value":988,"key":850},[1191,1192],{"value":991,"key":1179},{"value":976,"key":866},"all - web - cpm_sd (ancho premium)","bfa00079-54a7-3ce7-88ba-6a2de0537bb8",{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":596,"enabledForRegistered":6,"enabledForAnonymous":6,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":912},"1000087","0b1126b4-4b73-3454-9508-8f0ab0c9fd63",{"lazyLoadSensibilityDesktop":896,"headScripts":-1,"customStyles":-1,"lazyLoadSensibilityMobile":895},"1000056",{"name":1201,"positions":1202,"id":1233,"published":6,"typeAlias":1089,"config":1234,"adMapId":1237},"mz - amp - noticia registrado",{"footer":1203,"pageStealers":-1,"columns":-1,"htmls":1208,"header":1216,"skies":-1,"repeatPattern":-1,"banners":1221},[1204],{"data":1205,"name":1011,"id":1012,"published":6,"typeAlias":1013,"config":-1,"adPositionId":1014,"slotBitMask":-1},{"targeting":1206,"html":1010,"type":868},[1207],{"value":849,"key":850},{"bodyStart":1209},[1210],{"data":1211,"name":1213,"id":1214,"published":6,"typeAlias":938,"config":-1,"adPositionId":1215,"slotBitMask":-1},{"html":1212},"u003Camp-iframe width="auto" title="User Sync" height=1 layout="fixed-height" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" frameborder="0" class="sync-ad-pixel iframe-pixel-richaudience" src="https://sync.richaudience.com/3a786fc1b019f44a8b7d3e216dc4ac53/">u003Camp-img layout="fill" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" placeholder>u003C/amp-img>u003C/amp-iframe>","all - amp - user sync","d3859510-8b75-3534-a76f-4c62c4970731","1000089",[1217],{"data":1218,"name":1076,"id":1077,"published":6,"typeAlias":1013,"config":-1,"adPositionId":1078,"slotBitMask":-1},{"targeting":1219,"html":1075,"type":890},[1220],{"value":946,"key":850},{"underTag":1222},[1223,1228],{"data":1224,"name":1022,"id":1023,"published":6,"typeAlias":1013,"config":1227,"adPositionId":1025,"slotBitMask":-1},{"targeting":1225,"html":1021,"type":890},[1226],{"value":882,"key":850},{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":896,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":596},{"data":1229,"name":1039,"id":1040,"published":6,"typeAlias":1013,"config":1232,"adPositionId":1042,"slotBitMask":-1},{"targeting":1230,"html":1038,"type":868},[1231],{"value":903,"key":850},{"delay":8,"locationMobile":-1,"orderMobile":596,"lazyLoad":8,"order":912,"enabledForRegistered":8,"enabledForAnonymous":8,"enabledForSubscribers":8,"enabledForBitMask":596},"6327ec94-5274-3e3f-9b86-8fea9dc01f23",{"lazyLoadSensibilityDesktop":-1,"headScripts":1235,"customStyles":1236,"lazyLoadSensibilityMobile":-1},"u003Cscript src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-next-page-1.0.js" custom-element="amp-next-page" async>u003C/script>",".sync-ad-pixel{margin:0px;padding:0px;}n.site-header .site-header__content{top:0;}namp-ad:not(amp-ad[type="doubleclick"]):before{display:none;}n.ad-container amp-embed+span.ad-signature{display:none;}namp-ad[hidden]+.ad-signature{display:none;}n.ft-ad--roba:has(amp-ad[type="teads"],amp-ad[type="sunmedia"],amp-ad[type="teads"],amp-embed) {min-height: 0;max-width: unset;}n.ft-ad:has(amp-ad[type="teads"],amp-ad[type="sunmedia"],amp-ad[type="teads"],amp-embed)::before {display:none;}","1000085",{"prerollAmp":1239,"premium":1240,"preroll":1241,"main":1240},"mz/mz-generico/vc/amp","mz/general/kultur/noticia","mz/mz-generico/vc",{"ampVastUrl":1243},"https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x360|640x480|480x360|480x361&iu=/138855687/nacional-[adunit-video-amp]&ciu_szs&impl=s&cust_params=p%3Dcpm_preroll%26platform%3Damp%26plcmt%3D1%26[custom_params]&gdfp_req=1&env=vp&ad_rule=1&output=vmap&unviewed_position_start=1&plcmt=1&vpmute=0&url=[url]&description_url=[url]&correlator=[timestamp]","{n "admessage": "El anuncio terminará en xx s",n "adscheduleid": "WCsW6FRA",n "client": "googima",n "cuetext": "Anuncio",n "schedule": [n {n "offset": "pre",n "tag": "https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x360&iu=/138855687/nacional-[adunit-video]&ciu_szs=1x1,728x90,970x90,980x90,970x250,980x250,620x72,300x250,300x600,980x45,320x50,320x100&impl=s&cust_params=p%3Dcpm_preroll%26plcmt%3D2%26[custom_params]&gdfp_req=1&env=vp&ad_rule=0&output=vast&vpos=preroll&plcmt=2&unviewed_position_start=1&url=[url]&description_url=[url]&gdpr=__gdpr__&gdpr_consent=__gdpr_consent__&correlator=__random-number__",n "type": "linear"n },n {n "offset": "post",n "tag": "https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=640x360&iu=/138855687/nacional-[adunit-video]&ciu_szs=1x1,728x90,970x90,980x90,970x250,980x250,620x72,300x250,300x600,980x45,320x50,320x100&impl=s&cust_params=p%3Dcpm_preroll%26plcmt%3D2%26[custom_params]&gdfp_req=1&env=vp&ad_rule=0&output=vast&vpos=postroll&plcmt=2&unviewed_position_start=1&url=[url]&description_url=[url]&gdpr=__gdpr__&gdpr_consent=__gdpr_consent__&correlator=__random-number__",n "type": "linear"n }n ],n "skipmessage": "Saltar en xx s",n "vpaidcontrols": true,n "vpaidmode": "insecure"n}","138855687",{"premiumKicker":-1,"premiumShowButton":8,"premiumButtonUrl":-1,"premiumShowKicker":8},{"hideRelations":8,"oldContent":8},[],{"expirationMinutes":408,"isPersistent":8,"appOptions":1250,"webOptions":1252,"title":1254,"body":330},{"sendPush":8,"notificationButtons":1251},[],{"sendPush":8,"notificationButtons":1253},[],"Nieder mit dem Kult um das "perfekte" Quadrat: Was uns die k",{"origin":-1,"type":-1,"editor":416,"category":1256,"agencies":1257,"adsTypes":1258},"inf-general",[],[],{"bodyStart":1260,"header":1261,"bodyEnd":1262},"u003C!-- start tms v1.11 (noscript) -->nu003Cnoscript>u003Ciframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-K3F8ZWT"nheight="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">u003C/iframe>u003C/noscript>nu003C!-- end tms v1.11 (noscript) -->nu003C!-- start comscore tag (noscript) -->nu003Cnoscript>n u003Cimg src="https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=8731705&cv=3.6.0&cj=1">nu003C/noscript>nu003C!-- end comscore tag (noscript) -->","u003C!-- Activar Cabecera Piano -->nu003Cscript>var enableHeroPianoSticky=true;u003C/script>nnu003C!-- ID5 -->nu003Cscript>window.ID5EspConfig={partnerId:1326};u003C/script>nnu003C!-- PIMe Collect -->nu003Cscript>nt(function() {nttvar a = window.location.hostname;ntta = a.substring(a.lastIndexOf(".", a.lastIndexOf(".") - 1) + 1);nttswitch (a) {nttcase "lne.es":nttcase "diaridegirona.cat":nttcase "diariodeibiza.es":nttcase "diariodemallorca.es":nttcase "farodevigo.es":nttcase "informacion.es":nttcase "levante-emv.com":nttcase "laopinioncoruna.es":nttcase "superdeporte.es":nttcase "laopiniondemalaga.es":nttcase "laopiniondemurcia.es":nttcase "laopiniondezamora.es":nttcase "laprovincia.es":nttcase "regio7.cat":nttcase "eldia.es":nttcase "mallorcazeitung.es":nttcase "emporda.info":nttcase "diariocordoba.com":nttcase "stilo.es":nttcase "codigonuevo.com":nttcase "elperiodicomediterraneo.com":nttcase "elperiodicodearagon.com":nttcase "elperiodicoextremadura.com":nttcase "sport.es":nttcase "elperiodico.com":nttcase "elperiodico.cat":nttcase "epe.es":nttcase "elcorreogallego.es":nttcase "elcorreoweb.es":nttcase "lacronicabadajoz.com":nttcase "neomotor.com":ntttbreak;nttdefault:nttta = "prensaiberica.es"ntt}nttvar b = document.createElement("script");nttb.type = "text/javascript";nttb.src = "https://analytics-cdn." + a + "/static/javascript/mo_wp.min.js";nttdocument.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b)nt}nt)();tnu003C/script>nu003C!-- End PIMe Collect -->nnu003C!-- Start Chartbeat AB Test -->nu003Cscript type="text/javascript">n!function(){var n=window._sf_async_config=window._sf_async_config||{};n.uid=63417,n.domain=window.location.hostname.split(".").slice(-2).join("."),n.useCanonical=!1,n.useCanonicalDomain=!1,n.path=window.location.pathname,n.flickerControl=!1}();nu003C/script>nu003Cscript>if("/"===window.location.pathname){const e=document.createElement("script");e.src="//static.chartbeat.com/js/chartbeat_mab.js",e.async=!0,document.head.appendChild(e)}u003C/script>nu003C!-- End Chartbeat AB Test -->nnu003C!-- start gtm -->nu003Cscript>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':nnew Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],nj=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l="+l:"';j.async=true;j.src=n'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);n})(window,document,'script','dataLayer','GTM-K3F8ZWT');u003C/script>nu003C!-- end gtm -->nnu003Cscript>n (function () {n window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };n var slotsFirstCallPI = [n '300izdad',n 'cpm_fmega',n '980',n 'cpm_me'n ];n var executePostMessage = function () {n if (!googletag.pubadsReady || googletag.pubads().getSlots().length u003C 2) {n setTimeout(executePostMessage, 200);n console.log("googletag.pubadsReady undefined, waiting...");n return;n }n console.log("[PUBLICIDAD] execute post message fired");n var prefix = screen && screen.width u003C 768 ? "movil-" : "pc-";n googletag.cmd.push(function () {n slotsFirstCallPI.forEach(function (slot) {n var slot_refresh = prefix + "div-gpt-ad_" + slot;n googletag.pubads().getSlots()n .filter(function (s) {n return s.getSlotElementId() == slot_refresh;n })n .forEach(n function (s) {n googletag.pubads().refresh([s], { changeCorrelator: false });n }n );n });n });n }nn var enableRefreshAds = function () {n if (window.app && window.app.ads && window.app.ads.adMap) {n app.ads.adMap.disableRefreshAd = false;n }n if (typeof module != "undefined" && module.siteConfigOptions) {n module.siteConfigOptions.disableRefresh = false;n }n googletag.enableServices();n }nn if (!location.pathname.match(/\/fotos\/.*\.html/)) {n console.log("[PUBLICIDAD] no es url de fotos");nn if (window.app && window.app.ads) {n app.ads.flagManager.subscribe(app.ads.flagManager.flags.CMP_READY | app.ads.flagManager.flags.ADS_INITIALIZED, function () {n executePostMessage();n });n } else {n executePostMessage();n }nn window.ADNPM = window.ADNPM || {}; ADNPM.cmd = ADNPM.cmd || [];n var script = document.createElement("script");n script.type = "text/javascript";n script.src = "https://cdn.netpoint-media.de/1270735.js";n document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(script);n } else {n // esta parte se ejecuta en bitban todavían console.log("[PUBLICIDAD] es url de fotos");n enableRefreshAds();n if (window.app && window.app.ads) {n app.ads.flagManager.subscribe(app.ads.flagManager.flags.CMP_READY | app.ads.flagManager.flags.ADS_INITIALIZED, function () {n googletag.pubads().refresh();n });n } else {n googletag.pubads().refresh();n }n }n })();nu003C/script>nu003Cstyle>n div[id*='div-gpt-ad_'] {n min-height: 0px !important;n }nn #pc-div-gpt-ad_728 {n text-align: centern }nu003C/style>nu003C!-- Meta Pixel Code -->nu003Cscript>n!function(f,b,e,v,n,t,s)n{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?nn.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};nif(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';nn.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;nt.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];ns.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',n'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');nfbq('init', '785493233455956');nfbq('track', 'PageView');nu003C/script>nu003Cnoscript>u003Cimg height="1" width="1" style="display:none"nsrc="https://www.facebook.com/tr?id=785493233455956&ev=PageView&noscript=1"n/>u003C/noscript>nu003C!-- End Meta Pixel Code -->","u003Cscript>n(function () {nvar incluir_secciones = ["all"];nvar seccion_default = "all";nvar seccion_portada = seccion_default;nvar portadas = {n "all": 'u003Caside class="new new__related">u003Ca href="https://www.mallorcazeitung.es/?marketing=portadas-secciones" title="Lesen Sie hier alle Nachrichten der Mallorca Zeitung" class="new__media">u003Cpicture class="image">u003Cimg alt="Lesen Sie hier alle Nachrichten der Mallorca Zeitung" src="/clip/f6aef173-1b0d-48f1-8f87-4ede2b548cfa_source-aspect-ratio_default_0.jpg">u003C/picture>u003C/a>u003Cheader>u003Ca href="https://www.mallorcazeitung.es/?marketing=portadas-secciones" title="Lesen Sie hier alle Nachrichten der Mallorca Zeitung" class="new__headline">u003Ch2>Lesen Sie hier alle Nachrichten der Mallorca Zeitungu003C/h2>u003C/a>u003C/header>u003C/aside>'n };nif (incluir_secciones.includes(seccion_portada))n{n var html_portada = portadas[seccion_default];n if (seccion_portada in portadas)n html_portada = portadas[seccion_portada];n var parrafos = document.querySelectorAll('.article-body--seo-closed p.article-body__text');n if (parrafos.length > 1)n {n if (parrafos[parrafos.length-2])n {n parrafos[parrafos.length-2].insertAdjacentHTML("afterend", html_portada);n }n }n}n} ());nu003C/script>","115508564",{"thematicContents":1265,"relatedContents":1266,"internalTags":1267,"playersSummaries":1276,"relatedDataSheets":1277,"featuredHtml":-1,"externalRelatedContents":1278},[],[],[1268],{"internalTagId":1269,"published":6,"name":1270,"dates":1271,"id":1274,"originalId":1275,"description":-1,"parent":-1},"1591527","Portada sección",{"updateDate":1272,"createDate":1273,"releaseDate":-1,"lastModifiedDate":-1},["Date","2021-06-25T08:45:56.000Z"],["Date","2021-06-25T08:45:56.000Z"],"432d0447-cabd-3698-8696-73870ca983ee","REGIONALES_1591527",[],[],[],[1280],{"name":322,"id":385,"originalId":386,"title":322,"url":387,"image":388,"description":389,"authorInformation":-1,"active":6,"urls":1281},{"sourceUrl":-1,"redirectUrl":-1,"mainUrl":387,"epigraphUrl":-1},{"Surrogate-Key":1283,"xkey":1283},"maz_f7bf25d5-d51c-3874-a961-91c935ffd359 maz_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca_bc maz_section_explicitContent_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_networkCode_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_content_admap_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_articleAmp_admap_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_contentPremium_admap_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_contentPremiumAmp_admap_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_content_adunit_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_contentPremium_adunit_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_video_adunit_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_videoAmp_adunit_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_vastUrl_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_ampVastUrl_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_adScheduleVideo_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_geoblock_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_analyticsCategory_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_freeformHtmls_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_customization_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_section_categoryContents_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_2025-03-21 maz-all",{"id":1285,"categoryId":519,"links":1286},"860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca_bc",[1287,1290],{"urls":1288,"level":896,"name":524,"active":6,"id":525,"url":527},{"redirectUrl":1289,"mainUrl":527,"contentsUrl":803},null,{"urls":1291,"level":895,"name":352,"active":6,"id":519,"url":521},{"redirectUrl":1289,"mainUrl":521,"contentsUrl":1292},"/kultur/ausstellungen",{"menuLinks":1294,"navBarLinks":1295,"sideBarLinks":1296,"ampSideBarLinks":1297,"sideBarLinksItemsLinks":1298,"themesLinks":1299,"editionLinks":1300,"mobileLinks":1301,"headers":1302,"breadcrumbSubItems":1304},{},[],[],[],[],[],[],[],{"Surrogate-Key":1303,"xkey":1303},"maz_b9152f7e-96d3-375d-8848-0814d70016d7 maz_860bd03d-0fe1-3dd7-9c82-995be4f299ca maz_siteconfig_mainMenu maz-all",[1305,1308,1310,1313,1314,1317],{"url":1306,"title":1307,"text":1307},"https://www.mallorcazeitung.es/aktuelles/","Aktuelles",{"url":1309,"title":213,"text":213},"https://www.mallorcazeitung.es/meinung/",{"url":1311,"title":1312,"text":1312},"https://www.mallorcazeitung.es/sport/","Sport",{"url":527,"title":524,"text":524},{"url":1315,"title":1316,"text":1316},"https://www.mallorcazeitung.es/boulevard/","Boulevard",{"url":1318,"title":1319,"text":1319},"https://www.mallorcazeitung.es/service/","Service",{"navBarLinks":1321,"sidebarLinks":1322,"navBarLinksItemsSection":1323,"themesLinks":1324,"editionLinks":1325,"breadcrumb":1326},[],[],[],[],[],{},{"headers":1282,"errorHeadersData":-1},{"adUnit":47,"idPost":47,"isPreview":8,"boardId":47,"positionAds":1096,"positionsPreview":1329,"adsJs":1330,"countOrderMobile":596,"rawPageStealers":1333,"ampPageStealerOrder":895,"publishedRawPageStealersParagraphs":1334,"ordersMobile":1335,"ordersBoard":-1,"ordersBoardSimple":-1,"ordersBannersHorizontal":-1,"ordersDesktop":1336,"countAdsRightMobile":596,"countAdsRightLiveMobile":596,"countAdsRightSectionAutomaticMobile":596,"hasShowFirstRoba":8,"countOrderBoardPageStealerPc":896,"countOrderBoardPageStealerMobile":896,"countOrderBoardPageStealerSimplePc":896,"countOrderBoardPageStealerSimpleMobile":896,"showInTextElement":1337,"pageType":1338},{},{"moduleInit":1331,"esiAdsScripts":1332},"let module = {"adMap":{"name":"all - web - noticia registrado","positions":{"footer":[{"data":{"targeting":[{"value":"cpm_fmega","key":"p"}],"mapping":[{"value":"[[1,1],[728,90],[980,90],[990,90],[970,90],[990,45],[990,50],[980,45],[980,50],[970,50]]","key":"[990,0]"},{"value":"[[1,1],[728,90],[980,90],[970,90],[980,45],[980,50],[970,50]]","key":"[980,0]"},{"value":"[[1,1],[728,90],[970,90],[970,50]]","key":"[970,0]"},{"value":"[[1,1],[728,90],[320,50],[320,53],[320,100]]","key":"[728,0]"},{"value":"[[1,1],[320,50],[320,53],[320,100],\"fluid\"]","key":"[0,0]"}],"sizes":"[[1, 1]]","slot":"cpm_fmega","type":"local"},"name":"all - web - cpm_fmega","id":"5b117aeb-6c14-3642-82d7-a36956ca3fbc","published":true,"typeAlias":"adserverAdPosition","config":{"delay":true,"orderMobile":0,"lazyLoad":false,"order":0,"enabledForRegistered":true,"enabledForAnonymous":true,"enabledForSubscribers":false,"enabledForBitMask":3},"adPositionId":"1000019","slotBitMask":"cpm_fmega-3"}],"columns":{"right":[{"data":{"targeting":[{"value":"cpm_r_dcha","key":"p"}],"mapping":[{"value":"[[1,1],[300,250],[300,300],[300,600],\"fluid\"]","key":"[768,0]"},{"value":"[[1,1],[300,600],[336,280],[320,480],[300,250],[300,300],[250,250],[300,100],\"fluid\"]","key":"[0,0]"}],"sizes":"[[1, 1]]","slot":"300dcha","type":"nacional"},"name":"all - web - cpm_r_dcha","id":"d51e6032-66d7-3fc8-984f-e07e21b44627","published":true,"typeAlias":"adserverAdPosition","config":{"delay":false,"locationMobile":"Bajo párrafo del cuerpo","orderMobile":2,"lazyLoad":false,"order":1,"enabledForRegistered":true,"enabledForAnonymous":false,"enabledForSubscribers":false,"enabledForBitMask":2},"adPositionId":"1000004","slotBitMask":"300dcha-2"},{"data":{"targeting":[{"value":"cpm_r_dcha","key":"p"}],"mapping":[{"value":"[[1,1],[300,250],[300,300],[300,600],\"fluid\"]","key":"[768,0]"},{"value":"[[1,1],[300,600],[336,280],[320,480],[300,250],[300,300],[250,250],[300,100],\"fluid\"]","key":"[0,0]"}],"sizes":"[[1, 1]]","slot":"300dcha","type":"nacional"},"name":"all - web - cpm_r_dcha","id":"d51e6032-66d7-3fc8-984f-e07e21b44627","published":true,"typeAlias":"adserverAdPosition","config":{"delay":false,"locationMobile":"Bajo temas destacados","orderMobile":0,"lazyLoad":false,"order":1,"enabledForRegistered":false,"enabledForAnonymous":true,"enabledForSubscribers":false,"enabledForBitMask":1},"adPositionId":"1000004","slotBitMask":"300dcha-1"},{"data":{"targeting":[{"value":"cpm_r_dchab","key":"p"}],"mapping":[{"value":"[[1,1],[300,250],[300,300],[300,600],\"fluid\"]","key":"[768,0]"},{"value":"[[1,1],[300,600],[336,280],[320,480],[300,250],[300,300],[250,250],[300,100],\"fluid\"]","key":"[0,0]"}],"sizes":"[[1, 1]]","slot":"300dchab","type":"local"},"name":"all - web - cpm_r_dchab","id":"de5b8131-a464-315a-aeee-41406df6606d","published":true,"typeAlias":"adserverAdPosition","config":{"delay":false,"locationMobile":"Bajo párrafo del cuerpo","orderMobile":6,"lazyLoad":false,"order":3,"enabledForRegistered":true,"enabledForAnonymous":false,"enabledForSubscribers":false,"enabledForBitMask":2},"adPositionId":"1000005","slotBitMask":"300dchab-2"},{"data":{"targeting":[{"value":"cpm_r_dchab","key":"p"}],"mapping":[{"value":"[[1,1],[300,250],[300,300],[300,600],\"fluid\"]","key":"[768,0]"},{"value":"[[1,1],[300,600],[336,280],[320,480],[300,250],[300,300],[250,250],[300,100],\"fluid\"]","key":"[0,0]"}],"sizes":"[[1, 1]]","slot":"300dchab","type":"local"},"name":"all - web - cpm_r_dchab","id":"de5b8131-a464-315a-aeee-41406df6606d","published":true,"typeAlias":"adserverAdPosition","config":{"delay":false,"locationMobile":"Bajo temas destacados","orderMobile":0,"lazyLoad":false,"order":3,"enabledForRegistered":false,"enabledForAnonymous":true,"enabledForSubscribers":false,"enabledForBitMask":1},"adPositionId":"1000005","slotBitMask":"300dchab-1"},{"data":{"targeting":[{"value":"cpm_r_dchac","key":"p"}],"mapping":[{"value":"[[1,1],[300,250],[300,300],[300,600],\"fluid\"]","key":"[768,0]"},{"value":"[[1,1],[300,600],[336,280],[320,480],[300,250],[300,300],[250,250],[300,100],\"fluid\"]","key":"[0,0]"}],"sizes":"[[1, 1]]","slot":"300dchac","type":"nacional"},"name":"all - web - cpm_r_dchac","id":"bed06774-7bf1-30ce-b3eb-146d1f1f2f96","published":true,"typeAlias":"adserverAdPosition","config":{"delay":false,"locationMobile":"Bajo párrafo del cuerpo","orderMobile":11,"lazyLoad":true,"order":5,"enabledForRegistered":true,"enabledForAnonymous":false,"enabledForSubscribers":false,"enabledForBitMask":2},"adPositionId":"1000009","slotBitMask":"300dchac-2"}]},"header":[{"data":{"targeting":[{"value":"cpm_m","key":"p"}],"mapping":[{"value":"[[1,1],[728,90],[980,90],[980,180],[728,250],[990,90],[980,200],[980,250],[990,200],[990,250],[970,90],[970,250],[990,45],[990,50],[980,45],[980,50],\"fluid\"]","key":"[990,0]"},{"value":"[[1,1],[728,90],[980,90],[980,180],[728,250],[980,200],[980,250],[970,90],[970,250],[980,45],[980,50],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],\"fluid\"]","key":"[980,0]"},{"value":"[[1,1],[728,90],[728,250],[970,90],[970,250],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],\"fluid\"]","key":"[970,0]"},{"value":"[[1,1],[728,90],[728,250],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],\"fluid\"]","key":"[728,0]"},{"value":"[[1,1],[320,50],[320,53],[320,100],[300,50],[300,53],[300,100],\"fluid\"]","key":"[0,0]"}],"sizes":"[[1, 1]]","slot":"728","type":"nacional"},"name":"all - web - cpm_m","id":"0b8fc971-2947-3e7b-bee9-8a0492fb7691","published":true,"typeAlias":"adserverAdPosition","config":{"delay":false,"orderMobile":0,"lazyLoad":false,"order":0,"enabledForRegistered":true,"enabledForAnonymous":true,"enabledForSubscribers":false,"enabledForBitMask":3},"adPositionId":"1000001","slotBitMask":"728-3"}],"skies":{"left":[{"data":{"targeting":[{"value":"cpm_si","key":"p"}],"mapping":[{"value":"[[1,1],[120,600],[120,1000],[160,1000],[160,600],[450,1000]]","key":"[1505,0]"},{"value":"[]","key":"[0,0]"}],"sizes":"[[1, 1]]","slot":"skyizda","type":"nacional"},"name":"all - web - cpm_si (ancho premium)","id":"b00750c2-8010-3aef-8087-4a544279a2be","published":true,"typeAlias":"adserverAdPosition","config":{"delay":false,"orderMobile":0,"lazyLoad":false,"order":0,"enabledForRegistered":true,"enabledForAnonymous":true,"enabledForSubscribers":false,"enabledForBitMask":3},"adPositionId":"1000086","slotBitMask":"skyizda-3"}],"right":[{"data":{"targeting":[{"value":"cpm_sd","key":"p"}],"mapping":[{"value":"[[1,1],[120,601],[120,1001],[160,1001],[160,601],[450,1001]]","key":"[1505,0]"},{"value":"[]","key":"[0,0]"}],"sizes":"[[1, 1]]","slot":"skydcha","type":"nacional"},"name":"all - web - cpm_sd (ancho premium)","id":"bfa00079-54a7-3ce7-88ba-6a2de0537bb8","published":true,"typeAlias":"adserverAdPosition","config":{"delay":false,"orderMobile":0,"lazyLoad":false,"order":0,"enabledForRegistered":true,"enabledForAnonymous":true,"enabledForSubscribers":false,"enabledForBitMask":3},"adPositionId":"1000087","slotBitMask":"skydcha-3"}]}},"id":"0b1126b4-4b73-3454-9508-8f0ab0c9fd63","published":true,"typeAlias":"adMapContent","config":{"lazyLoadSensibilityDesktop":1,"lazyLoadSensibilityMobile":2},"adMapId":"1000056"},"adUnits":{"prerollAmp":"mz/mz-generico/vc/amp","premium":"mz/general/kultur/noticia","preroll":"mz/mz-generico/vc","main":"mz/general/kultur/noticia"},"compliant":"yes","isPremiumContent":1,"pageId":"115508564","premiumEnabled":0,"tagepi":["kunstler","kunst","madrid","casal-solleric","palma","mallorca","ausstellungen","art-palma-brunch"],"hasPrebid":true,"media":"mz","target":"_noticia","disableAds":"no","disableNoAdserverAds":"no","disableAdsInImage":"no","openContentData":false,"pageType":["noticia"]};n const slotTargetings = {"leftSky":"cpm_si","rightSky":"cpm_sd","footer":"cpm_fmega","header":"cpm_m"};","u003Cesi:include src="/cds-statics/esi/ads/index.html" />n n u003Cesi:include src="/cds-statics/esi/site/config/no" />n u003Cesi:include src="/cds-statics/esi/ads/gam360.js" />n u003Cesi:include src="/cds-statics/esi/ads/scriptsPrebid.js" />n ",[],[],{"300dcha":895,"300dchab":911,"300dchac":927},{"300dcha":896,"300dchab":912},{"1":8,"2":8,"mobile1":6,"desktop1":6,"mobile2":6,"desktop2":6},[1339],"noticia",{"positionAds":1096,"slotsRobaAll":1341,"slotsRobaNoRepeat":1348,"hasShowFirstRoba":6,"rightRobaShowed":912,"rightRobaShowedData":1352,"rightRobaShowedLiveData":1356,"rightRobaShowedLive":596},[1342,1344,1345,1346,1347],{"title":882,"id":889,"positionMobile":895,"positionDesktop":896,"bitMask":1120,"position":894,"user":1343},"anonymous",{"title":882,"id":889,"positionMobile":596,"positionDesktop":896,"bitMask":1130,"position":1129,"user":1343},{"title":903,"id":907,"positionMobile":911,"positionDesktop":912,"bitMask":1139,"position":894,"user":1343},{"title":903,"id":907,"positionMobile":596,"positionDesktop":912,"bitMask":1148,"position":1129,"user":1343},{"title":919,"id":923,"positionMobile":927,"positionDesktop":928,"bitMask":1157,"position":894,"user":1343},[1349,1350,1351],["Reactive",1342],["Reactive",1345],["Reactive",1347],[1353,1354,1355],"movil-div-gpt-ad_300dcha-2","movil-div-gpt-ad_300dchab-2","movil-div-gpt-ad_300dchac-2",[],{"idMissedIt":519,"section":1358},{},{"authorPage":-1},{"board":-1,"seeMorePage":895,"seeMoreContentViews":1361,"contentViewUrlWithPage":1362,"initialModule":1363,"initialSlot":1364,"bottomScripts":47,"compositionVersionId":596,"isBoardComplete":6,"isEditModule":6,"isTypeLayout100":6,"isEditModeHomeItem":8,"parentModuleType":-1,"parentSlotType":-1,"isEditModeBoard":8,"globalSafeMode":6,"isFirstImage":8,"imagesOpeningTwoPlusOne":596,"totalPagesSectionList":896,"idsItems":1365,"sectionListCGId":-1},[],[],{},{},[],{"analyticsModulesFromData":1367,"jwplayer_rer":1368,"login":1369,"newrelic_int":1370,"newrelic_pre":1371,"newrelic_prod":1372,"renr_header":1373,"scoreboard":1374,"dsStylesByBrand":1375,"fourty-ads_skys-sticky.js":1380,"fourty-header-sticky.js":1381,"fourty-js-tabs.js":1382},"d1f79011","7949b560","1ebdf72b","0cb01f18","eeff6f7c","d3279b9b","ad0e49ac","1239634a",{"epe":1376,"ep":1377,"sport":1378,"regionales":1379},"7c3f3aaf","22da4080","a785fa23","c85a163b","a8f79a33","2bb0d062","ebba10ce"]
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Was uns die knalligen Gefängnisse des Künstlers zu sagen haben puedes visitar la categoría Sociedad.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

Otras noticias parecidas